Haben Sie Probleme beim lesen dieser E-Mail Lesen Sie die Onlinevariante
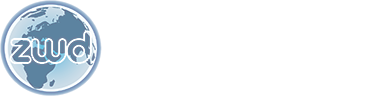 zwd-POLITIKMAGAZIN: NEWSLETTER GLEICHSTELLUNG & BILDUNG 03/2023 |
|
Liebe Leserinnen und Leser, |
|
Der Absturz vom Gipfel Bergsteiger:innen wissen: je höher der Aufstieg, desto dünner wird die Luft oben und umso größer die Gefahr, auf der Höhe den Halt unter den Füßen zu verlieren, gerade dann, wenn das Schuhwerk und die Kletterausrüstung nicht ausreichen. So bildlich geschehen im BCC, dem Berliner Congress Center, wohin am 14. und 15. März FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eingeladen hatte – zu einer zweitägigen Veranstaltung, genannt "Bildungsgipfel". Schon seit der Debatte über den nationalen Bildungsbericht am 18. Januar dieses Jahres im Bundestag war klar, dass das Vorhaben der Ministerin wenig erfolgversprechend sein würde. Zu „unprofessionell vorbereitet“ lautet der Vorwurf der maßgeblichen Bildungspolitiker:innnen aus den Ländern. Scholz und die Regierungschef:innen sind gefordert Auch in der Ampel-Koalition herrscht Unzufriedenheit über den Kurs der Ministerin, mit der dieses ursprünglich von der SPD in den Koalitionsvertrag hineinverhandelte Vorhaben zum Absturz gebracht wurde. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP noch festgeschrieben: „Wir werden einen Bildungsgipfel einberufen, auf dem sich Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über neue Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen.“ Davon war dieses „Gipfelchen“, wie die Presse spöttisch resümiert, meilenweit entfernt. Der Weg zum Gipfel, musste Stark-Watzinger einsehen, war für sie zu weit und zu hoch. Es war kein Gipfel, sondern allenfalls eine ansprechende Fachtagung mit begrenztem Mehrwert für die pädagogische Praxis. Gefordert gewesen wäre und ist jetzt noch mehr ein Neuanfang zur Schadensbegrenzung: ein Gipfel mit maßgeblicher Beteiligung der Regierungschef:innen von Bund und Ländern, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sowie der Spitzen der Zivilgesellschaft, beispielsweise auch aus Gewerkschaften und Unternehmerorganisationen. Im Zusammenwirken mit den Spitzen der Koalitionsparteien und im Rahmen einer Verständigung mit der Opposition (CDU/CSU und LINKE) könnte so dem ehrgeizigen Ampel-Vorhaben der notwendige Schwung mit Nachhaltigkeit verliehen werden. Den Schaden, dass ihre Parteifreundin derart abstürzte, können die Freien Demokraten allein kaum noch wieder gut machen, denn deren Zustimmung in Meinungsumfragen ist ohnehin im Keller. Die erste Stufe der Wahlrechtsreform – ohne Paritätsregelung Die Wahlrechtsreform ist das zweite Thema, das mit der Verabschiedung des Ampel-Gesetzentwurfs zur Verkleinerung des Bundestages auf nunmehr 630 Abgeordnetensitze an diesem Freitag Bedeutung erlangt hat. Die mehr als 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich zum Bündnis „ParitätJetzt!“ zusammengeschlossen haben, sind „not amused“ über die Tatsache, dass die Wahlrechtskommission des Bundestages ihren Auftrag, Vorschläge für eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern zu unterbreiten, bisher nur unzulänglich verfolgt hat. Die Kommission, die seit Beginn des Jahres nicht mehr tagt, brütet inzwischen bereits auf der Grundlage einer Sekretariatsvorlage der Kommission ihren Schlussbericht aus, der im April fertiggestellt sein soll. Nach vorliegenden Einschätzungen läuft in der Tendenz der Schlussbericht bislang auf die Ergebnisbeschreibung des Zwischenberichts hinaus, dass über gesetzliche Paritätsregelungen „kein Einvernehmen“ bestehe. Die gleichstellungspolitisch engagierten Organisationen, allen voran der Deutsche Frauenrat (DF), wollen sich damit nicht abfinden. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: Paritätsregelungen im zweiten Schritt Mut macht ihnen dabei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Sie hat in einem Antwortschreiben an die Gesellschaft Chancengleichheit (Logo), die Mitherausgeberin des zwd-POLITIKMAGAZINs, betont, dass nach dem Beschluss über die Verkleinerung des Bundestages in einem zweiten Schritt die Paritätsfrage angegangen werden solle.
Eine Gesetzesergänzung, die auf dem diese Woche im Bundestag anhängigen Entwurf aufbaut, haben die Mitglieder der Wahlrechtskommission, die Staatsrechtlerin Prof.in Silke R. Laskowski (Universität Kassel) und die ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin Elke Ferner (DF und UN Women Deutschland), bereits zur Diskussion gestellt. Ob deren Paritäts-Entwurf zum Zuge kommt oder sich nur als Minderheitenvotum im Abschlussbericht niederschlägt, hängt in der Ampel-Koalition von den Freien Demokraten ab. Sie haben bisher alle Bemühungen um Paritätslösungen blockiert. Das muss nicht so bleiben, denn das bisherige Verhalten der FDP-Vertreterinnen in der Wahlrechtskommission hat nun parteiintern FDP-Frauen auf den Plan gerufen, die sich mit dem (daran sichtbar werdenden) Erscheinungsbild der von Parteichef Christian Lindner geprägten und nach seinem Vorbild agierenden „Jungen Männer" in der Partei nicht länger abfinden wollen. Gelegenheit, sich zu erklären, haben die FDP-Frauen und -Männer am morgigen Freitag (17.03.2023), wenn der Bundestag seine vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag abhält. 16mal ja zur Parität: Ressortchef:innen aller 16 Länder Auch in den Ländern kommt allmählich die Paritätsdebatte in Gang. Die bayerischen Grünen haben jetzt im Landtag in München einen Paritätsgesetzentwurf eingebracht. In anderen Ländern werden ähnliche Initiativen vorbereitet. Im zwd-POLITIKMAGAZIN (Ausgabe 395) haben alle in der Gleichstellungs- und Frauenminister:innen-Konferenz der Länder (GFMK) vertretenen Ressortchef:innen mit einem Testimonial ihre Unterstützung für die Kampagne „ParitätJetzt!“ erklärt.
Das ist ein guter Auftakt für den Start der zweiten Welle der Kampagne, die nach der Verabschiedung des 25. Wahlrechtsänderungsgesetzes durch den Bundestag anlaufen soll. Die gleichstellungspolitische Debatte nimmt Fahrt auf. Im Juni, wenn die GFMK zu ihrer Jahrestagung zusammenkommt, wird das Teilhabe-Thema auf der Tagesordnung stehen. Ein lesenswertes Interview mit der brandenburgischen Frauenministerin und amtierenden GFMK-Vorsitzenden Dr.in Ursula Nonnemacher haben wir im https://www.zwd.info/im-zwd-politikmagazin-ressort..., veröffentlicht. |
| zwd-Nachrichten |
|
|
| Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe unter anderem: |
|
NHALT DER AUSGABE 395 des zwd-POLITIKMAGAZINs In der Titelgeschichte der Ausgabe 395 des zwd-POLITIKMAGAZINs geht es in der Abteilung
Eine Intitiative der Gesellschaft Chancengleichheit und des zwd-POLITIKMAGAZINs“ (Seite 8)
zwd-INTERVIEWs mit
BUNDESSTIFTUNG - GLEICHSTELLUNGSTAG In der Abteilung BILDUNG & POLITIK geht es um den Nationalen Bildungsbericht und den Lehrkräftemangel BUNDESTAG, 18.01.2023 TOP 3 – NATIONALER BILDUNGSBERICHT BILDUNG IN DEUTSCHLAND 2022 LEHRKRÄFTEMANGEL DIE LETZTE SEITE Wenn Sie noch nicht Bezieher:in des zwd-POLITIKMAGAZINs sind, können Sie nicht alles lesen. Entscheiden Sie sich für ein zeitlich befristetes Schnupper-Abonnement der Print- oder Digitalausgabe. Den Weg dorthin finden Sie hier. |
|
Newsletter Bezieher*innen, die dieses Angebot nicht mehr nutzen wollen, können sich mit folgendem Link austragen lassen: Newsletter abmelden | Newsletter Resorts anpassen |
|
Abonnent*innen bitten wir, entsprechende Änderungen in Ihrem Userprofil vorzunehmen. Sie gelangen in das Userprofil, indem sie sich in einem der beiden Portale einloggen und in der rechten Navigation auf "Userprofil" klicken. Dort können Sie dann entsprechende Änderungen vornehmen. Herausgeber aller Newsletter ist die zwd-Mediengruppe (zwd-Mediengesellschaft mbH in Kooperation mit der zweiwochendienst Verlags-GmbH). Verantwortlich i.S.d.P ist: Holger H. Lührig Anschrift: zwd-Redaktion Müllerstraße 163 13353 Berlin Tel: 030-50 60 33 88 Fax: 032-12 740 0757 redaktion@zwd.info |


/zwd-POLITIKMAGAZIN_395_Digitalteilausgabe_F___P_Febr_23_final_S1_klein_2.jpg)