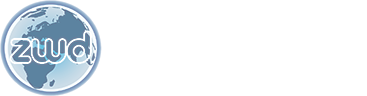zwd Berlin. Der Förderschwerpunkt im Forschungsetat liegt im Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drs. 21/ 600) wie im laufenden Haushaltsjahr (Drs. 21/ 500, zwd-POLITIKMAGAZIN berichtete) auf der Wettbewerbsfähigkeit des Innovationssystems, für den die bereitgestellten Finanzen einen geringfügigen Aufwuchs auf 8,3 Mrd. Euro (+ 0,2 Mrd.) erfahren. Höhere Mittel erhält mit 2,14 Mrd. Euro der Zukunftsvertrag Studium und Lehre für flächendeckend hochwertige Angebote an Universitäten und die Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftssystems mit rund 889 Mill. Euro (+ 134,8 Mill.). wobei den größten Ausgabenbetrag 515 Mill. Euro für die Exzellenzstrategie zur Förderung universitärer Spitzenforschung (+ 115,3 Mill.) bilden.
BAföG-Mittel sinken um fast 250 Mill. Euro
Finanzielle Einbußen von fast 1,5 Mrd. Euro verzeichnet der Haushaltsplan für Leistungsfähigkeit des Bildungswesens und Nachwuchsförderung, welche die Regierung mit ca. 4,5 Mrd. Euro einpreist (2025: 6,00 Mrd.). Die für das BAföG veranschlagten Mittel sinken mit bloß noch 1,78 Mrd. stetig weiter (2025: 2,00 Mrd.), für geförderte Studierende werden dabei 1,14 Mrd. Euro verfügbar gemacht (- 248 Mill.), für Schüler:innen 507 Mill. Euro (- 41 Mill.). Demgegenüber steigen die Finanzen für das Modernisieren und Stärken beruflicher Bildung leicht auf 388 Mill. Euro (+ 80,2 Mill.) und die Unterstützung des Lernens im Lebenslauf auf 512,4 Mill. Euro (+ 164,5 Mill). Für Innovationsforschung und Hightech Agenda als zweiten Förderschwerpunkt hat die Regierung wieder Finanzen in Höhe von rund 8,18 Mrd. Euro eingestellt.
Rückgang bei BAföG-Geförderten um 4 Prozent
Wie aus aktuellen Daten von Destatis (18. August/ 01. August) hervorgeht, sank die Zahl der BAföG-Geförderten 2024 um 4 Prozent auf knapp 612.800. Fast 80 Prozent der Empfänger:innen der staatlichen Leistung waren demnach Studierende, der Personenkreis verringerte sich von vorher 501.400 auf 483.800 Geförderte (- 17.600)..Nach einem leichten, insgesamten Anstieg 2022 (+ 7.220 Personen) und 2023 (+ 12.590 Personen) bedeutet das eine Abnahme um rund 22.800 Geförderte, bis auf den tiefsten Wert seit dem Jahr 2000. Die Sprecherin für Forschung und Technologie der Grünen-Bundestagsfraktion Ayşe Asar nannte die rückläufigen BAföG-Empfänger:innen-Zahlen „ein bitteres Signal“.
Die Grünen fordern BAföG-Bedarfssätze wie beim Bürgergeld
Asar monierte, dass die Bundesregierung, anstatt gegenzusteuern, weitere Einsparungen plane. Diese „mutlose“ Haushaltspolitik sieht die Grünen-Politikerin im Widerspruch zur im Koalitionsvertrag angekündigten großen BAföG-Reform. Bisher sei völlig ungeklärt, wie die anvisierten Verbesserungen zu finanzieren sind, bemängelte sie. Asar forderte daher ein BAföG, „das existenzsichernd und bedarfsgerecht ist“, was für sie konkret u.a. heißt Bedarfssätze wie beim Bürgergeld, eine an Ortsmieten angepasste Wohnkostenpauschale, erhöhte Freibeträge und weniger von den Eltern abhängige Förderung. „Wir brauchen jetzt eine echte Reform, die Bildungsgerechtigkeit herstellt“, so Asar. Durchschnittlich erhielten BAföG-Empfänger:innen nach Angaben von Destatis 2024 eine monatliche Unterstützung von 635 Euro, bei Studierenden beliefen sich die Förderbeträge auf im Mittel 657 Euro, etwas mehr als bei Schüler:innen (539 Euro)). 10.700 Erstsemester:innen profitierten bis Dezember von der zum Wintersemester 2024/ 25 eingeführten Studienstarthilfe mit einmalig jeweils 1.000 Euro.
Ähnlich kritisch wie die Grünen-Sprecherin äußerte sich der DSW-Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl zur BAföG-Statistik. Die staatliche Förderleistung sei zu gering bemessen und erreiche zu wenige Studierende, allein durch „ein BAföG-Bekenntnis des Bundes“ lasse sich eine Trendwende bewirken. „Das BAföG muss höher, einfacher und digitaler werden“, verlangte Anbuhl. Der DSW-Vorsitzende appellierte an die Regierung, diese solle die Koalitionsversprechen „kraftvoll umsetzen“. Angesichts der im aktuellen Haushaltsentwurf vorgesehenen Absenkung der BAföG-Mittel zweifelte Anbuhl, wie ernst es der Regierung mit der in Aussicht gestellten BAföG-Reform tatsächlich sei. Diese hält er für überfällig, sie stelle eine zentrale Zusicherung der Regierung an die Student:innen dar.
DSW: Finanzen für BAföG-Reform im Bundeshaushalt verankern
Anbuhl schlug vor, die BAföG-Finanzen mittelfristig im Bundeshaushalt zu verankern und „möglichst rasch die gesetzgeberische Arbeit“ zu beginnen, damit die im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Änderungen noch im Verlaufe dieser Legislaturperiode umgesetzt würden. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, „das BAföG in einer großen Novelle (zu) modernisieren“. Sie streben an, „die Wohnkostenpauschale (…) zum Wintersemester 2026/27 einmalig auf 440 Euro pro Monat“ zu erhöhen und diese regelmäßig zu überprüfen. Die Freibeträge sollen dynamisiert und der „Grundbedarf für Studierende (…) in zwei Schritten (hälftig zum Wintersemester 2027/28 und 2028/29) dauerhaft an das Grundsicherungsniveau“ angepasst werden.
Der DSW-Vorsitzende Anbuhl trat außerdem für ein umfassend digitalisiertes, vereinfachtes Prozedere bei BAföG-Anträgen und -Bearbeitung sowie für eine Informations-Offensive ein. Einer neuen, vom Fraunhofer Institut für Informationstechnik vorgelegten Studie zufolge stelle über die Hälfte eigentlich BAföG-berechtigter Student:innen keinen Antrag auf die staatliche Förderhilfe. Anbuhl riet, das Problem über einen Bundes-BAföG-Bot zu lösen, der seiner Auffassung nach „Abhilfe schaffen“ könne, ein Gedanke, für den sich nach Aussagen des DSW-Vorsitzenden auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CDU, vgl. das Interview im DSW-Journal 2-3/ 2025) offen zeige.