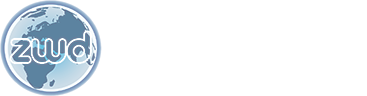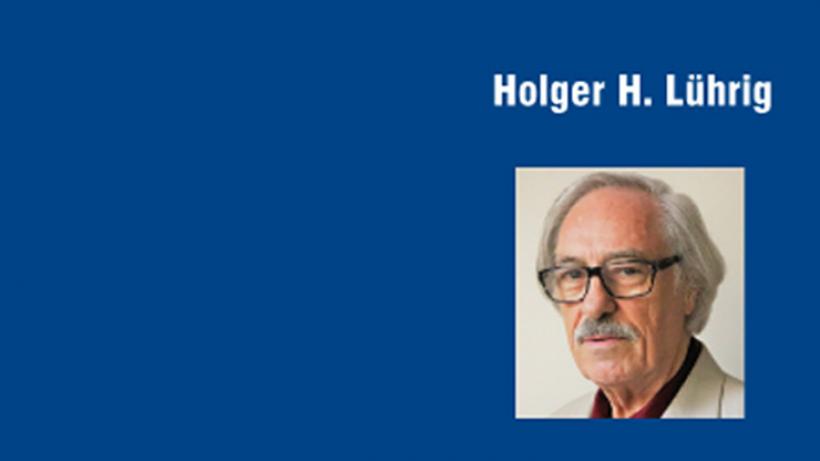KOMMENTAR: Holger H. Lührig
So hätte es wirklich nicht kommen müssen. Den vielversprechenden – und herbeigelobten – Start der neuen schwarz-roten Bundesregierung hat die CDU-Partei- und Fraktionsspitze durch unprofessionelles Agieren selbst vermasselt.
Dabei hatten die Koalitionäre ihren Vertrag und die Ressortsverteilung doch eigentlich so solide gestrickt: Sowohl Unionschrist:innen als auch Sozialdemokrat:innen sollten ihre Möglichkeiten bekommen zu eigener Profilierung, ohne mit der anderen Koalitionspartnerin zu sehr ins Gehege zu geraten. Für den Ressortzuschnitt bedeutet das zugunsten der Union neben dem Kanzleramt die Zuständigkeiten für Äußeres, Inneres und Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Familie, Forschung sowie für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Mehr als bei dem mageren Wahlergebnis zu erwarten war, konnte sich die SPD unter Führung ihres Parteichefs Lars Klingbeil die einflussreichen Ressorts für Finanzen, Verteidigung, Arbeit und Soziales, Justiz, Wohnungsbau und wirtschaftliche Zusammenarbeit sichern. Insgesamt war das nach der Beschreibung des Bundeskanzlers keine „Liebesheirat“, aber eine „Arbeitskoalition“ mit großen Gestaltungsmöglichkeiten für beide Seiten.
Wie üblich hatte sich die Koalition darauf verständigt, gemeinsam und nicht gegeneinander abzustimmen. Doch schon bei der ersten Nagelprobe – dem ersten Wahlgang zur Kanzlerwahl – ging das schief. Grüne und Linke mussten mithelfen, dass es schnell zum 2. Wahlgang kam, in dem dann Merz die erforderliche Stimmenmehrheit erhielt. Trotz dieses Stolperstarts hatte der Kanzler anfangs mit seinen internationalen Auftritten in der Demoskopie punkten können, gerade auch im Vergleich zum Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD). Doch inzwischen gehen die Zustimmungswerte für Merz schon wieder zurück. Das hat mit innerparteipolitischen Kalamitäten in der Union zu tun.
Bereits mit der Auflockerung der Schuldenbremse zugunsten von 500 Milliorden Euro zur Herstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur hatte der CDU-Chef seine Anhängerschaft irritiert. Schließlich hatte Merz bis zum Wahltag versichert, eine solche Reform werde es mit der Union nicht geben. Dann die Nichteinlösung des Versprechens, die Stromsteuer für alle zu senken und nun das Desaster mit der Wahl neuer Verfassungsrichter:innen.
Der Kanzler versuchte die Startprobleme mit internen „Kommunikationsmängeln“ kleinzureden. Doch in Wirklichkeit hat er ein veritables Personalproblem, das einen Namen trägt: Jens Spahn. Doch das kann Merz (noch) nicht lösen. Er weiß, dass er den Fraktionschef, der gewohnt ist, eigene Süppchen zu kochen, nicht einfach aus dem Feld räumen kann, beispielsweise als Botschafter in Moskau oder in Peking. Auch nicht, um Spahns milliardenschwere Maskenaffäre erst einmal vergessen zu machen, die den Ex-Gesundheitsminister wie ein Mühlstein belastet. Denn Spahn steht als Hoffnungsträger für den Rechtsaußen-Flügel seiner Partei und Fraktion. Auf deren Stimmen ist Merz zum Regieren angewiesen.
Spahn hat seinen politischen Standort mit unverhohlenen Sympathien schon für den damaligen Präsidentschaftskandiaten der Republikaner Donald Trump ebenso deutlich gemacht wie mit seiner Empfehlung, die AfD in den Gremien des Bundestages wie eine „normale Partei“ zu behandeln. Seine Nähe zu selbsternannten „Lebensschützern“ ist bildlich dokumentiert. Seine Gegnerschaft gegen jegliche Liberalisierung des Abtreibungsrechts pfeifen die Spatzen von den Bundestagsdächern. Spahn wird sogar nachgesagt, er strebe bei einem vorzeitiugen Scheitern von Merz und dem Ende von Schwarz-Rot eine Kanzlerschaft mit Unterstützung der AfD an.
Vor diesem Hintergrund hat der scheinbar unprofessionelle Umgang des Fraktionschefs mit der Vorlage des Bundestags-Richterwahlausschusses Zweifel an seiner Rolle aufkommen lassen. Immerhin war die erforderliche Zweidrittel-mehrheit für den Vorschlag zur Wahl von drei neuen Verfassungsrichter:innen in dem 12-köpfigen Bundestagsgremium mit den Stimmen der fünf Abgeordneten aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zustandegekommen. Im Vorfeld hatten Spahn und Parteichef Friedrich Merz diesen Wahlvorschlag abgesegnet, also auch den Vorschlag der SPD für die Bundesverfassungsrichterin in spe, Prof.in Dr.in Frauke Brosius-Gersdorf. Aber wollte Spahn das auch selbst?
Hinter der vermeintlich spontanen Empörung gegenüber der Nominierung von Brosius-Gersdorf steckt, wie jetzt erkennbar, eine von längerer Hand gezielt vorbereitete Kampagnenstrategie rechter Netzwerke und Medien. Insofern steht die Frage im Raum, warum der Fraktionschef es zuließ, dass sich die Koalition selbst „beschädigt“ hat, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgedrückt hat. Fühlte sich Spahn als ein Getriebener aufgrund von Koalitionsabsprachen mit der SPD? Wurde er zum Werkzeug rechter Netzwerke oder war er sogar derjenige, der sich an die Spitze der vielleicht 30 bis 50 Unionsabgeordneten gesetzt hat, mit deren Stimmverhalten die Wahl der in Fachkreisen hochangesehenen Professorin Brosius-Gersdorf torpediert werden sollte? Viele Fragen hat der hier sehr schweigsame Spahn unbeantwortet gelassen – anders als in der Maskenaffäre, bei der Spahns Zukunft ebenfalls auf dem Spiel steht. Auf Spahns Konto geht, dass die Arbeitskoalition schon nach weniger als 70 Tagen ernstlich ins Straucheln gekommen ist – sogar viel früher als die Ampel. In Koalitionskreisen und den Medien wird angesichts der Zerrissenheit in der Unionsfraktion die Frage gestellt, wie lange die sogenannte „Arbeitskoalition“ überhaupt durchhalten kann. Der Kanzler hat sich mit der Erklärung aus der Krise zu flüchten versucht, dass er den Abgeordneten in dieser Frage das Recht auf eine „Gewissensentscheidung“ zubilligt. In Wirklichkeit führt er damit die Koalition in instabile Verhältnisse. Diese Ausrede könnte in anderen Fällen Schule machen, indem von langer Hand vorbereitete Inszenierungen zu Gewissensfragen stilisiert werden. Die nächsten Streitfälle stehen – Stichwort Sozialreform – schon ante portas und werden sich nicht einfach lösen lassen.