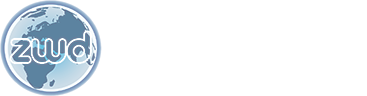Veröffentlichung von FidAR vom 01.05.2025
Der Durchbruch für mehr gleichberechtigte Teilhabe kam nur mit gesetzlichem Druck
Vor 10 Jahren wurde die entscheidende Wende für die gleichberechtigte Teilhabe in den Führungspositionen der deutschen Wirtschaft eingeleitet: Am 1. Mai 2015 – Tag der Arbeit – trat das erste Führungspositionengesetz (FüPoG) in Kraft. Heute steht fest: Die FüPo-Gesetze sind in weiten Teilen eine Erfolgsgeschichte. Die Rankings der WoB-Indizes von FidAR zeigen eindeutig: Nie waren so viel Frauen in Führungspositionen der Privatwirtschaft und öffentlicher Unternehmen vertreten. Dennoch: es bleibt noch viel zu tun, denn Parität in Führungsgremien ist noch lange nicht flächendeckend erreicht. Und der Gegenwind für die gleichberechtigte Teilhabe – insbesondere aus den USA – wird stärker.
Die entscheidenden Veränderungen für mehr Frauen in Spitzengremien wurden erst durch das FüPoG ermöglicht, hier die Einführung einer Geschlechterquote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen, eine Pflicht zur Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsräten, Vorständen, und den obersten Managementebenen der privaten und öffentlichen Unternehmen, die entweder börsennotiert oder mehr als 500 Beschäftigte hatten sowie weiterführende Regelungen zur Steigerung des Frauenanteils in den Führungsebenen öffentlicher Unternehmen, die mehrheitlich dem Bund unterstehen. Mit dem FüPoG II erfolgte 2022 eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen, nachdem freiwillig zu wenig umgesetzt worden war. Es kam das Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände als wesentliche Erweiterung hinzu, zudem wurden die Regelungen zu den Zielgrößen verschärft.
I. Erfolgszahlen
Die Zahlen sprechen für sich: Noch nie waren so viele Frauen in den Spitzengremien deutscher Unternehmen vertreten. 10 Jahre nach Inkrafttreten des ersten FüPoG liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der Privatwirtschaft bei 37,5 Prozent (2015: 19,9 %) – in den öffentlichen Unternehmen werden 38,9 Prozent (2015: 24,1 %) erreicht. In den Vorständen ist der Frauenanteil in den Börsenunternehmen auf 20,2 Prozent (2015: 5 %), in den öffentlichen Unternehmen auf 31 Prozent (2015: 13,1 %) gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Women-on-Board-Index und des Public Womenon-Board-Index von FidAR mit Stand April 2025.
Der Vergleich der Unternehmen, die unter die gesetzlichen Regelungen fallen, mit den Unternehmen, für die keine Vorgaben oder nur die Verpflichtung zur Benennung von Zielgrößen gelten, zeigt eindeutig die Wirksamkeit der verbindlichen gesetzlichen Vorgaben. Sowohl in den Aufsichtsgremien als auch in den Vorständen stieg der Frauenanteil bei den Unternehmen, die seit 2015 der festen Quote im Aufsichtsrat unterliegen, deutlich stärker als bei jenen, die nicht den gesetzlichen Regelungen unterliegen.
In den Aufsichtsgremien aller derzeit 179 im DAX, MDAX und SDAX sowie der im Regulierten Markt notierten, paritätisch mitbestimmten Unternehmen stieg der durchschnittliche Frauenanteil seit 2015 insgesamt um 17,6 Prozentpunkte auf 37,5 Prozent (siehe Abbildung 1). Die aktuell 100 der Aufsichtsratsquote unterliegenden Unternehmen erreichen mit 38,6 Prozent einen höheren Anteil, bei einem Plus von 17,3 Prozentpunkten. Die 79 nicht unter die Quote fallenden Unternehmen legten um 20,4 Prozentpunkte auf 34,1 Prozent zu.
Bei den Vorständen sind die Unterschiede noch deutlicher (siehe Abbildung 2): Die unter die Quote im Aufsichtsrat fallenden Unternehmen erzielen einen Spitzenwert von 23,4 Prozent (+18,5), während die nicht der Quote unterliegenden Unternehmen bei nur 14,8 Prozent verharren (+9,6). Insgesamt vervierfachte sich der Frauenanteil in den Vorständen in den 10 Jahren seit Einführung der Aufsichtsratsquote von geringen 5 Prozent auf 20,2 Prozent (+15,2).
Auch im öffentlichen Sektor zeigt sich, dass die Entwicklung hin zu einer stärkeren Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen bei den Bundesunternehmen deutlich schneller ist als bei den Beteiligungen der Länder. Denn die gesetzlichen Regelungen gelten hier verstärkt für die Bundesbeteiligungen. So greift das Bundesgremienbesetzungsgesetz bereits ab zwei vom Bund zu besetzenden Aufsichtsratspositionen.
So stieg bei den 101 im Public Women-on-Board-Index von FidAR untersuchten Bundesbeteiligungen der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien seit 2015 um 17,3 Prozentpunkte auf 41,2 Prozent, während die untersuchten 158 Landesbeteiligungen nur 37,3 Prozent erreichen, bei einem Plus von 13 Prozentpunkten über 10 Jahre (siehe Abbildung 3). Ähnlich verhält es sich bei der Entwicklung des Frauenanteils in den Top-Managementorganen – auch hier liegen die Bundesbeteiligungen mit 32,4 Prozent Frauenanteil deutlich von den Landesbeteiligungen mit 29,9 Prozent, bei einem Zuwachs von 18,4 (Bund) bzw. 17,5 (Länder) Prozentpunkten (siehe Abbildung 4).
II. Gesetzliche Vorgaben entscheidend
Mit der Geschlechterquote kam vor 10 Jahren der entscheidende Durchbruch. Ohne gesetzlichen Druck gab es zuvor trotz einer existierenden freiwilligen Selbstverpflichtung der damaligen DAX-30-Unternehmen quasi keinen Fortschritt. Doch mit dem Inkrafttreten des Gesetzes hat in den betroffenen Unternehmen die gleichberechtigte Teilhabedeutlich zugenommen. Die Quote wirkt dabei sogar über die Besetzung der Aufsichtsgremien hinaus: Während die Börsenunternehmen den Frauenanteil in den Aufsichtsräten fast verdoppelten, stieg der Frauenanteil in den Vorständen um das Vierfache. Veränderung ist also möglich – doch bisher leider nur, wenn gesetzlicher Druck entsteht.
III. Reichweite (noch) zu gering
Die Erfolgsbilanz der gesetzlichen Regelungen spricht dafür, die festen Geschlechterquoten auf mehr Unternehmen auszuweiten. Denn die Geschlechterquote für den Aufsichtsrat gilt lediglich für Unternehmen, die börsennotiert und paritätisch mitbestimmt sind – und dies sind aktuell nur 100 Unternehmen. Das Mindestbeteiligungsgebot im Vorstand gilt sogar nur für 61 dieser 100 Unternehmen der Privatwirtschaft. Denn betroffen sind nur börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen, die mehr als drei Personen im Vorstandsgremium haben. Im Öffentlichen Sektor gilt die Regelung lediglich für 43 Bundesbeteiligungen mit mehr als zwei Mitgliedern im Top-Managementorgan.
Die Freude über die Wirksamkeit der gesetzlichen Vorgaben wird daher getrübt durch deren geringe Reichweite. Es erscheint somit konsequent, den wirksamen Hebel fester Quoten auf eine größere Anzahl an Unternehmen auszuweiten, um die gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen nicht mehr als Sonderfall zu sehen, sondern um Parität in Führungspositionen zu einer gesellschaftlichen Normalität zu entwickeln. Dabei sollte insbesondere jene Gruppe von Unternehmen eingebunden werden, die ebenfalls im FüPoG adressiert werden und bereits heute verpflichtet sind, Zielgrößen für Aufsichtsgremium, Vorstand sowie die 1. und 2. Managementebene zu benennen. Dies sind Unternehmen, die börsennotiert sind oder mehr als 500 Beschäftigte haben und damit der Mitbestimmung im Aufsichtsrat unterliegen. Damit würden deutlich mehr private Unternehmen ebenso wie öffentliche Beteiligungen des Bundes, der Länder und der Kommunen einbezogen. Unabhängig von den Verschärfungen der Gesetze gilt der deutsche Verfassungsgrundsatz nach Art 3 Abs. 2. „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungspositionen sollte Normalität sein.
IV. Rückschläge aus den USA
Aktuell steht die Erfolgsbilanz bei der gleichberechtigten Teilhabe unter massivem Druck aus den USA: Gleich am Tag seines Amtsantritts im Januar verbot Präsident Donald Trump per Dekret den Einsatz sogenannter „Diversity, Equity and Inclusion“-Initiativen (DEI) in Bundesbehörden. Doch das Vorgehen richtet sich nicht nur gegen den lokalen öffentlichen Sektor. Auch Unternehmen, Universitäten und Non-Profit-Organisationen mit Verbindungen zur US-Regierung stehen im Visier. Als Reaktion auf die US-Vorgaben hat der Softwarekonzern SAP entschieden, das Ziel, einen Anteil von 40 Prozent Frauen in der Belegschaft zu erreichen, nicht mehr fortführen. Auch bei der Vorstandsvergütung soll Diversität künftig kein Bewertungsmaßstab mehr sein. Bei SAP besteht ohnehin - unabhängig von der Frage des Umgangs mit der DEI-Politik der Trump-Regierung - Handlungsbedarf beim Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland. Aktuell liegt der Konzern mit einem Frauenanteil von 27,8 Prozent im Aufsichtsrat und 16,7 Prozent im Vorstand deutlich unter dem durchschnittlichen Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Börsenunternehmen. Als SAP vor sechs Jahren wegen erfolgreicher Anstrengungen im Bereich der gleichberechtigten Teilhabe mit dem WoB-Award von FidAR ausgezeichnet wurde, lag der Frauenanteil im Aufsichtsrat noch bei 50 Prozent und im Vorstand bei 22 Prozent. Bis Anfang 2024 gehörte SAP noch zur Spitzengruppe der Unternehmen im Women-on-Board-Index von FidAR.
V. Fazit
In Deutschland und Europa besitzen die jeweiligen Landesgesetze ihre Gültigkeit. In den europäischen Nachbarländern, die die europäische Regelung übernommen haben, gilt mit der EU-Führungspositionenrichtlinie eine Geschlechterquote von 40 Prozent in den Aufsichtsgremien, und zwar in Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Rückschritte in Bezug auf die Vielfalt in den Entscheidungsgremien können somit zu einem Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen führen. Dies sollten Unternehmen berücksichtigen, damit sie im europäischen Verbund vereint und gegenüber einer aggressiven amerikanischen Handelspolitik gestärkt agieren. Besonders da die deutsche Wirtschaft wieder zum europäischen Motor aufsteigen will, sollte sie auch bei der Gleichstellung in der ersten Liga mitspielen.
Für Unternehmen heißt es also, gleichberechtigte Teilhabe „zu leben“ und so in ihrer Unternehmenskultur zu verankern, dass die in der deutschen Verfassung verbriefte Gleichberechtigung erreicht wird.
- Weiterführende Dateien:
 250616_BOARD_10-Jahre-Fuhrungspositionengesetz.pdf
250616_BOARD_10-Jahre-Fuhrungspositionengesetz.pdf