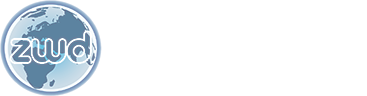Einleitend spricht Merz über eine „Alltagserfahrung, die Sie alle und die wir alle häufig in den Unternehmen und auch in der Politik machen“: Bei der Besetzung der Topstellen gehe es nicht immer nur nach tatsächlicher Leistung und tatsächlicher Befähigung. Andere Faktoren spielten eine Rolle, „und nicht selten begünstigen diese Faktoren die Männer und benachteiligen die Frauen.“ Merz fügt in seinen Worten „sehr ernst“ hinzu: Das sei „keine Lappalie“ und „vor allem kein ‚Frauenproblem‘“, sondern eine Frage gerechter Chancenverteilung. Unter Hinweis auf die von Generationen mutiger Frauen erkämpfte Rechtsordnung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau räumte Merz ein, „dass Gleichberechtigung in Verfassungen oder in Gesetzen allein noch keine Chancengerechtigkeit schafft, vor allem eben im Verhältnis der Geschlechter zueinander“.
Das zeige sich an der Besetzung von Führungspositionen, ob in der Wirtschaft, in der Politik oder in fast allen Bereichen der Gesellschaft: Bis zum mittleren Management seien Frauen meist keine Seltenheit mehr. „Aber eine Führungsebene darüber sind Sie als Frau dann plötzlich mit einer Gruppe von Männern weitgehend allein.“ Die Initiative Chef:innen:sache, die Personalverantwortliche großer Unternehmen und großer Organisationen aus unterschiedlichsten Bereichen repräsentiert, habe sich zusammengetan, um nachhaltig etwas in der Arbeitswelt zu verändern: „Sie wissen: Es schadet Ihren Unternehmen und Organisationen, wenn im Pool der potenziellen Führungskräfte eine Hälfte unserer Gesellschaft kaum Beachtung findet. Was für eine gigantische Verschwendung von Talenten! Wir wissen alle – ich weiß es aus meiner politischen wie aus meiner beruflichen Erfahrung –, dass gemischte Teams besser arbeiten. Sie sind innovativer, sie sind in Krisen resilienter, und sie treffen ausgewogenere Entscheidungen.“Im Interesse als Wirtschaftsnation, als Industriestandort „brauchen wir eben auch die Chefinnen, um als Wirtschaftsstandort innovativ, kreativ, resilient und krisenfest zu werden und zu bleiben.“ Er wisse, erklärt der Kanzler, dass Quoten allein nicht wirklich weiterbringen. „Wenn Spitzenfrauen an die sprichwörtliche gläserne Decke stoßen, dann liegt das oft an einer Mischung aus vielen Dingen: an mangelnden Vorbildern, an männerdominierten Netzwerken und Seilschaften, an unflexiblen Arbeitszeitmodellen, an Klischees, die immer noch in unseren Köpfen wirken. Führungsqualitäten wie Durchsetzungsstärke, Kompetenz, Entscheidungsfreude werden immer noch und häufig für männliche Tugenden gehalten, trotz aller Gegenbeweise“.
Unter Hinweis auf das erste, im Jahr 2015 in Kraft getretene Führungspositionengesetz habe die Politik in Deutschland „erst lernen müssen, auch wir in der CDU: Freiwilligkeit allein führt nicht immer zum Ziel. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für die Politik und für die politischen Parteien. Eine Quote mag unternehmerische Freiheit zunächst einmal kurzzeitig begrenzen. Mittel- und langfristig ist sie aber im Sinne der persönlichen Freiheit.“ Unverändert bestehe aber Handlungsbedarf: „Zuletzt waren es immer noch viele Hundert Unternehmen, die explizit eine Zielgröße von „null Frauen“ angegeben haben. Ich sage es noch einmal: Das ist nicht akzeptabel! Es gibt noch viel zu tun.“
Mit Blick auf den Bundesdienst mit seinen mehr als 600.000 Beschäftigten sieht sich der Kanzler auf einem ganz guten Weg und verweist dabei auf die Vorgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes; „Ziel ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen […] bis zum 31. Dezember 2025 zu erreichen.“
Vom Tag seiner Rede (am 2. Juli) her betrachtet, sehe er gute Chancen, zum Ende des Jahres 2025 eine Punktlandung hinzulegen. Denn laut der letzten Erhebung (Mitte 2024) habe der Frauenanteil an Führungspositionen im Bundesdienst bei 47 Prozent gelegen. Und: „Ich will, dass Deutschland zu einem Land wird, in dem die gläserne Decke der Vergangenheit angehört.“