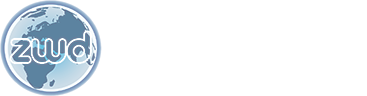Die Lebensentwürfe von jungen Frauen in Bezug auf Beruf und Kinder lassen sich unter den aktuellen politischen Bedingungen nur schwer verwirklichen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie ‚Frauen auf dem Sprung – das Update 2013’ des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung (WZB) und des infas Institus für angewandte Sozialwissenschaft im Auftrag der Zeitschrift Brigitte. Frauen stehen bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere „enorm unter Druck“, wie die Studie resümiert, und fühlen sich „von der Politik und den Männern hierbei zu wenig unterstützt“.
So würden Karrierewege, die laut Studie von 71 Prozent aller Frauen zwischen 21 und 34 angestrebt werden, durch Kinder deutlich erschwert. Dem steht ein Kinderwunsch von über 90 Prozent der Befragten gegenüber. Ohne eine seriöse Zeitpolitik, die ein familienfreundlicheres Arbeitszeitkontingent für Männer und Frauen garantiere, seien Frauen zwischen Familie und Karriere hin- und hergerissen.
Die Studie interviewte unter Leitung von Prof. Jutta Allmendinger Männer und Frauen, die zum Zeitpunkt der ersten Befragung 2007 den Altersgruppen 17 bis 19 und 27 bis 29 Jahren zugehörten. Auf einen Teil derselben Kohorte wurde auch bei der Vergleichsbefragung 2012 zurückgegriffen, um neben den Ergebnissen auch Trends auswerten zu können. Demnach lasse sich bei der Bedeutung von Erwerbstätigkeit und Geldverdienen ein „enormer gesellschaftlicher Wertewandel“ ablesen, so Allmendinger. Weniger die Erwerbstätigkeit als vielmehr Karriere und Führungspositionen stünden nunmehr bei Frauen im Zentrum. Auch in der Wahrnehmung von Männern sei dieser Trend zu beobachten: Im Jahr 2007 gaben noch 17 Prozent an, von ihrer Partnerin zu erwarteten, dass sie Geld verdient. Heute liege diese Zahl mit 45 Prozent um fast 30 Prozent höher. Als zunehmend schlechter schätzten Frauen und Männer jedoch die Möglichkeit ein, Karriere mit Kind zu machen. Insbesondere der ‚mommy-track’, wie Allmendiger Wiedereinstiegsprogramme nannte, führe Frauen von Führungspositionen eher weg. So gelinge nur Wenigen der Sprung von einer Teilzeitbeschäftigung wieder zurück auf eine Vollzeitstelle. In Teilzeit seien jedoch die Aufstiegschancen nicht mehr gegeben. Allmendiger fordert vor diesem Hintergrund eine politische Weichenstellung, die eine verminderte Wochenarbeitszeit zum Standard erhebt, als Vorschlag nannte sie unter anderem 32 Stunden.
Die frauenpolitische Sprecherin der GRÜNEN, Monika Lazar, hat in einer Pressemitteilung die Forderung nach Rahmenbedingungen unterstützt, die individuellen Bedürfnissen und Lebensentwürfen Rechnung tragen. Hierzu gehöre unter anderem eine bessere Verteilung von Arbeitszeit und Arbeitsvolumen zwischen den Geschlechtern, die eine größere Flexibilität im Lebensverlauf ermögliche. Außerdem seien Unternehmen in der Pflicht, „große Teilzeitstellen“ anzubieten und für diese Karrieremöglichkeiten zu eröffnen. Auch müsse neben dem Recht auf Teilzeit ein Recht darauf, die Arbeitszeit wieder anzuheben, geschaffen werden: „Die Entscheidung für Kinder darf für Frauen nicht bedeuten, dass im Beruf nichts mehr geht“.
So würden Karrierewege, die laut Studie von 71 Prozent aller Frauen zwischen 21 und 34 angestrebt werden, durch Kinder deutlich erschwert. Dem steht ein Kinderwunsch von über 90 Prozent der Befragten gegenüber. Ohne eine seriöse Zeitpolitik, die ein familienfreundlicheres Arbeitszeitkontingent für Männer und Frauen garantiere, seien Frauen zwischen Familie und Karriere hin- und hergerissen.
Die Studie interviewte unter Leitung von Prof. Jutta Allmendinger Männer und Frauen, die zum Zeitpunkt der ersten Befragung 2007 den Altersgruppen 17 bis 19 und 27 bis 29 Jahren zugehörten. Auf einen Teil derselben Kohorte wurde auch bei der Vergleichsbefragung 2012 zurückgegriffen, um neben den Ergebnissen auch Trends auswerten zu können. Demnach lasse sich bei der Bedeutung von Erwerbstätigkeit und Geldverdienen ein „enormer gesellschaftlicher Wertewandel“ ablesen, so Allmendinger. Weniger die Erwerbstätigkeit als vielmehr Karriere und Führungspositionen stünden nunmehr bei Frauen im Zentrum. Auch in der Wahrnehmung von Männern sei dieser Trend zu beobachten: Im Jahr 2007 gaben noch 17 Prozent an, von ihrer Partnerin zu erwarteten, dass sie Geld verdient. Heute liege diese Zahl mit 45 Prozent um fast 30 Prozent höher. Als zunehmend schlechter schätzten Frauen und Männer jedoch die Möglichkeit ein, Karriere mit Kind zu machen. Insbesondere der ‚mommy-track’, wie Allmendiger Wiedereinstiegsprogramme nannte, führe Frauen von Führungspositionen eher weg. So gelinge nur Wenigen der Sprung von einer Teilzeitbeschäftigung wieder zurück auf eine Vollzeitstelle. In Teilzeit seien jedoch die Aufstiegschancen nicht mehr gegeben. Allmendiger fordert vor diesem Hintergrund eine politische Weichenstellung, die eine verminderte Wochenarbeitszeit zum Standard erhebt, als Vorschlag nannte sie unter anderem 32 Stunden.
Die frauenpolitische Sprecherin der GRÜNEN, Monika Lazar, hat in einer Pressemitteilung die Forderung nach Rahmenbedingungen unterstützt, die individuellen Bedürfnissen und Lebensentwürfen Rechnung tragen. Hierzu gehöre unter anderem eine bessere Verteilung von Arbeitszeit und Arbeitsvolumen zwischen den Geschlechtern, die eine größere Flexibilität im Lebensverlauf ermögliche. Außerdem seien Unternehmen in der Pflicht, „große Teilzeitstellen“ anzubieten und für diese Karrieremöglichkeiten zu eröffnen. Auch müsse neben dem Recht auf Teilzeit ein Recht darauf, die Arbeitszeit wieder anzuheben, geschaffen werden: „Die Entscheidung für Kinder darf für Frauen nicht bedeuten, dass im Beruf nichts mehr geht“.