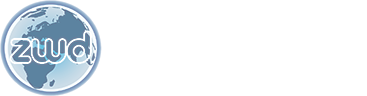Als Forum für Literatur und bildende Kunst stellt das Museum mit Else Lasker-Schüler (11.02.1869 – 22.01.1945) eine Frau in den Mittelpunkt, die ebenso wie dessen Namensgeber über Doppelbegabungen verfügte. Sie war wie Günter Grass Schriftsteller:in und Maler:in, seine Begabung „Bildhauer“ teilte sie jedoch nicht. Noch etwas hatte Lasker-Schüler mit Günther Grass gemeinsam: Beide rechneten mit den Nationalsozialisten ab – er in seinen Frühwerken, den Romanen „Die Blechtrommel“, „Katz und Maus“ und „Hundejahre“, sie in ihrem Spätwerk, dem zu Lebzeiten unveröffentlichtem Stück „IchundIch“. Neben der Dauerausstellung des berühmten Nobelpreisträgers für Literatur präsentiert das Museum bis zum 9. November 2025 nun die Ausstellung „Else Lasker-Schüler – Künstlerin, Dichterin, Weltenbauerin“.
„Es steht außer Frage, dass Lasker-Schüler bis zum Ende ein Ideal der weitreichenden Toleranz lebte“
Else Lasker-Schüler war eine unbequeme Künstlerin, die nicht nur gegen den Strom der Zeit geschrieben und gemalt, sondern auch gelebt hat. Mit der traditionellen Frauenrolle in der bürgerlichen Gesellschaft wollte sie sich nicht identifizieren und war damit ihrer Zeit weit voraus. Geschlechterrollen stellte sie in Frage und gab sich einen männlichen Namen. Ihre Inszenierung als Jussuf, Prinz von Theben in orientalischer Männerkleidung behielt sie ein Leben lang bei – von ihren Auftritten in Berliner Cafés bis zu ihrer letzten Lebensphase in Jerusalem. Eine Dread-Queen oder vielmehr ein Dread-King sei Lasker-Schüler gewesen, erklärte die Kuratorin Dr. Paula Vosse in NDRkultur.
Else Lasker-Schüler nahm sich alle Freiheiten als Frau heraus – künstlerische, politische, kulturelle und sexuelle –, mit denen sie in ihrer Zeit aneckte. Vor diesem Hintergrund war ihr Versuch, ein anerkanntes gesellschaftliches Leben zu führen, zum Scheitern verurteilt. Nach zwei Ehen war sie ab 1912 alleinerziehende Mutter ihres heißgeliebten Sohnes Paul.
1932 Kleistpreis, 1933 Emigration
Trotz der mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung wurde ihr Werk zu Literatur, das bis heute anspricht, gewürdigt. Gemeinsam mit Richard Billinger bekam sie 1932 als letzte Preisträgerin die damals höchste deutsche Literaturauszeichnung, den Kleistpreis. Ein Jahr später übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Lebensgefährlich für Else Lasker-Schüler, denn nun war ihr Status „Jüdin“ entscheidend.
Ob ihre Bücher bei der Bücherverbrennung am 1. April 1933 auch Opfer der Flammen wurden, ist nicht eindeutig belegt. Auf den Denkmälern erscheint ihr Name, doch „bisher konnte oder wollte die Forschung nicht nachweisen, ob auch ihre Bücher den Flammen übergeben worden sind“, heißt es auf der Webseite der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft. Ihre Bilder jedoch seien 1937 aus der Berliner Nationalgalerie als „entartet“ entfernt. Da lebte sie schon seit vier Jahren in Zürich.
Obwohl sie als Schulkind mit antisemitischen Vorfällen konfrontiert war und 1933 von Nazis niedergeschlagen wurde, gab sie bis zum Lebensende ihren Traum einer Freundschaft zwischen Juden, Christen und Arabern nicht auf. Bereits in der Weimarer Republik warb sie für eine Versöhnung mit ihnen. 1932 hat sie diesen Wunsch in dem Schauspiel „Arthur Aronymus und seine Väter“, „sozusagen Else Lasker-Schülers Nathan“ (Erika Klüsener) verewigt. Mit dem gemeinsam von Juden und Christen gefeierten Passahmahl am Ende des Textes malt sie ein idyllisches Bild der Versöhnung von Juden und Christen.
Ihr Traum vom Neben- und Miteinander der großen Religionen
Selbst als sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen war, hielt sie an diesem Traum fest. „Und doch geht hier Jude und Christ, Mohammedaner und Buddhist Hand in Hand. Das heißt, ein jeder begegnet dem Nächsten mit Verantwortung. Es ziemt sich nicht, hier im Heiligen Lande Zwietracht zu säen.“, schrieb sie 1937 in ihrem Buch „Das Hebräerland“ (Leibniz-Magazin, 04.04.2019).
Abrechnung mit dem Hitler-Regime
Erst wenige Jahre vor ihrem Tod, im Winter 1940/41, rechnet sie in der Tragödie „IchundIch“ mit dem Hitler-Regime ab. Bekannte Nazi-Größen wie Joseph Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Heß und Baldur von Schirach treten im Höllengrund, dem Ort der Handlung, in den Dialog mit den von Goethe entliehenen Personen Faust und Mephisto. Else Lasker-Schüler gibt jedoch Mephisto ein von der Goethe-Inszenierung abweichendes Gesicht: Dieser Teufel stellt sich den Nationalsozialisten entgegen. Alle sterben im Höllenschlamm – Hitler verliert „die geraubte Welt“.
Rückkehr in die Schweiz verweigert
1939 reiste Else Lasker-Schüler von der Schweiz, in die sie 1933 geflohen war, zum dritten Mal nach Palästina. Dieses Mal blieb ihr eine Rückkehr jedoch verwehrt, zum einen durch den Kriegsbeginn des nationalsozialistischen Deutschlands, zum anderen, weil die Schweizer Behörden durch die Verweigerung eines Rückreisevisums ihre Rückkehr nach Europa verhinderten. Glücklich wurde sie in ihrem Sehnsuchtsort „Hebräerland“ nicht. Im Januar 1945, 18 Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Paul, starb sie einsam und verarmt in Jerusalem.
Else Lasker-Schüler „wieder hochaktuell“
Ihr Werk jedoch lebt weiter. Zum Beispiel wurden ihre Dramen „Arthur Aronymus und seine Väter“ 2023 im Landestheater Detmold in der Fassung von Gerhard Hess und „IchundIch“ als Dokumentaroper des Komponisten Johannes Harneit 2019 in der Staatsoper Hamburg aufgeführt. Viele ihrer Werke wurden von verschiedenen Verlagen neu aufgelegt. Die im Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag erschienene „Kritischen Ausgabe“ (2010) enthält alle veröffentlichten und nachgelassenen Werke von Else Lasker-Schüler als Gesamtausgabe.Vor dem Hintergrund des „immer stärker werdenden Hasses auf fremde Kulturen und Menschen, die unter Todesgefahren nach Europa, nach Deutschland kommen“ (Lasker-Schüler-Gesellschaft),
seien die von Lasker-Schüler vor fast einem Jahrhundert gestellten Fragen „wieder hochaktuell“.