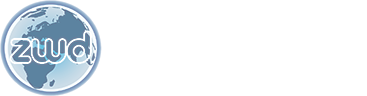zwd Berlin. Bei seiner ersten Rede vor dem Bundestag bekräftigte Kulturstaatsminister Weimer am Mittwoch erneut ,wie schon bei seinem Treffen mit dem Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland Dr. Josef Schuster am Tag nach seinem Amtsantrittt, seine Absicht, "Antisemitismus in Deutschland konsequenter zu bekämpfen". Für ihn gelte "eine Nulltoleranzpolitik gegen Antisemitismus", denn aus seiner Sicht gehöre es ganz wesentlich "zu unserer moralischen Integrität", dagegen aufzubegehren, wenn "Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher fühlen" in der Bundesrepublik und in Europa. Mit Blick auf die Erinnerungskultur betonte Weimer, "die Singularität des Holocaust" müsse uunmissverständlich deutlich bleiben, "Verharmlosung, Geschichtsrevisionismus oder (...) Relativismus" dürften hier keinen Platz haben. Der BKM kündigte an, seine Bundesbehörde werde Kulturprojekte, die auch bloß "im Ansatz oder versteckt" antisemitische Ziele verfolgten, künftig nicht finanziell weiterfördern.
BKM Weimer: Freie Debatten und Diskursräume erhalten
In einem kurzen Abriss seiner nächsten kulturpolitischen Pläne stellte Weimer die Bedeutung von "parteiübergreifendem Konsens" heraus, der z.B. für die anstehende Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes sowie seine Vorschläge für den Erhalt der Medienvielfalt und der Meinungsfreiheit erforderlich sei. Als Leitlinien dafür nannte er einerseits die "Europäisierung der Medienpolitik", die er auf verschiedenen Ebenen, vom zu erweiternden Auftrag der Deutschen Welle bis zur KI-Regulierung, vorantreiben werde. Andererseits hat Weimer vor, die freiheitliche Orientierung der Medienpolitik auf den Wettbewerb hin zu stärken, vor allem beim Umgang mit Online-Portalen. Deren "fast monopolistischen Strukturen" setzte er die "freie Debatte" und "Räume des Diskurses" entgegen, die es aufrechtzuerhalten und zu unterstützen gelte. Darüber hinaus forderte der BKM dazu auf, sich von "amerikanischen und chinesischen Digitalkonzernen" zu emanzipieren und unabhängig zu machen, da man in diesem Feld schon zu vulnerabel geworden sei. Weimer trat vor dem Parlament für eine "freiheitliche Kulturpolitik" ein, man solle nicht versuchen, Kultur wie auch Medien für die Politik zu instrumentalisieren. Er versicherte, er werde die Kulturpolitik weder in die linke noch die rechte Richtung rücken, sondern der "freien und kreativen Kultur" eng zur Seite stehen.
Lindh: Parlamentsabgeordnete an Entscheidungsprozessen beteiligen
Der Sprecher für Kulturpolitik der SPD-Bundestagsfraktion Helge Lindh ist mit seiner Bewertung für den eben erst ins Amt berufenen Weimer vorsichtig. Er möchte den neuen Kulturstaatsminister an seinen konkreten Taten messen. In einem Kommentar für den zwd vom 12. Mai. erklärte Lindh, er wünsche sich von dem BKM, dass er intensiv mit dem Bundestag zusammenarbeite. Der Anspruch der Parlamentarier/innen sei es, "mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden" zu werden. Das sei angesichts der aktuellen Kulturkämpfe, der "gesellschaftspolitischen Aufladung" im Kultur- und Medienbereich und aufgrund massiver bundesweiter finanzieller Einsparmaßnahmen dringend geboten. Die grüne Kulturpolitikerin Awet Tesfaiesus sieht demgegenüber Weimers Ernennung mit Sorge. Sie bezweifle, dass er das in Bibliotheken, Museen und Freie Szene gesetzte "hohe Vertrauen" stärken könne, teilte die Grünen-Politikerin dem zwd mit, da Weimer mit seinen Provokationen eher Fronten aufbaue, als zu verbinden. Was die Kultur jetzt brauche, sei "Überparteilichkeit, die mit Diplomatie unser kulturelles Erbe" schütze und Zusammenhalt fördere, so Tesfaiesus.
Am 06. Mai hatte der Kulturstaatsminister den Präsidenten des Zentralrats Schuster empfangen. Weimer sagte, er wolle „ein Zeichen setzen“ und die - im Zusammenhang mit israelfeindlichen Äußerungen auf der Berlinale 2024 und antisemitischen Darstellungen auf der documenta 2022 (zwd-POLITIKMAGAZIN berichtete) - in die Kritik geratene Beziehung zwischen BKM und jüdischer Community wiederherstellen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel zunehmenden Boykottaufrufen und gegen jüdische Künstler/innen gerichteten Aktionen werde er „mit aller Kraft“ entgegentreten.
Personalie Weimer unter Kulturfachleuten umstritten
Der Kulturspezialist der Linksfraktion im Bundestag David Schliesing und der Geschäftsführer des DK Olaf Zimmermann messen Weimers Ernennung zum neuen Kulturstaatsminister "entscheidende() Bedeutung" zu. Wie Schliesing im Interview mit dem zwd am 06. Mai vermutete, habe Friedrich Merz (CDU) über die Personalie offensichtlich nicht mit Blick auf "Qualifikation und Erfahrung" entschieden, die der Linken-Politiker und Kulturschaffende ihm im Bereich Kultur absprechen. Vielmehr dürfte sich mit dem "erzkonservativen" Publizisten und Medienverleger als BKM die "Wirtschaftsförderung im Medienbereich" intensivieren. Schliesing befürchtet, die Berufung des Staatsministers mit "reaktionäre(m) Kulturverständnis und Gesellschaftsbild" könnte Bekenntnisse der Koalition zur Förderung kultureller Vielfalt und künstlerischer Freiheit unterlaufen, die Union werde den seit Jahren geführten "Kulturkampf von rechts absehbar deutlich verschärfen".
Eine am Tag der Nominierung vom ensemble-netzwerk der darstellenden Künste auf dem Webportal innn.it gestartete Petition, die inzwischen über 71.300 Personen (07. Mai) unterschrieben haben, wendet sich mit dem Ziel an den mittlerweile vereidigten Bundeskanzler Merz und seinen Vize von der SPD Lars Klingbeil, die Besetzung der Position mit Weimer zu stoppen. Die Unterzeichner:innen halten ihn als Kulturstaatsminister für ungeeignet, die früher von ihm geleiteten Medien (Cicero, Welt, Fokus) würden eindeutig eine wirtschaftsliberale, rechtskonservative Richtung vertreten. Stattdessen brauche die Kulturpolitik in Zeiten "wachsender gesellschaftlicher Polarisierung" als BKM jemanden, der "Vielfalt, Demokratie und künstlerische Freiheit" fördert.
SPD: Staatsziel Kultur fehlt, Bund als „verlässlicher Kulturpartner"
Der SPD-Kultursprecher Lindh begrüßte die "zahlreichen zukunftsweisenden kultur- und medienpolitischen Initiativen", durch welche der von ihm mit verhandelte Koalitionsvertrag die bundesdeutsche Kulturinfrastruktur nachhaltig stärke. In einer Stellungnahme für den zwd bedauerte Lindh - wie Grüne, Linke und DK-Geschäftsführer Zimmermann -, dass das Unionsbündnis die von der SPD angestrebte Aufnahme des Staatsziels Kultur ins Grundgesetz (GG) nicht mitgetragen habe. Demgegenüber wertete er als bedeutsam, dass der Bund sich im Föderalismus als "verlässlicher Kulturpartner" positioniere, die Bundeskulturfonds weiterentwickle und Kultur als "Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge" anerkenne. Programme wie Kultur macht stark fortzusetzen, unterstreiche den Anspruch, "kulturelle Teilhabe flächendeckend zu sichern". Lindh mahnte jedoch als ausschlaggebend an, die Förderfonds des Bundes und die Freien Künste "dauerhaft und verlässlich auszustatten".
DK-Geschäftsführer Zimmermann schrieb in der von ihm herausgegebenen Zeitung Politik & Kultur (Mai 2025), 20 Jahre, nachdem die vom Bundestag beauftragte Enquete-Kommission diesbezüglich einstimmig eine Handlungsempfehlung vorgelegt habe, sei es an der Zeit, das GG im Artikel 20 um den Zusatz "Der Staat schützt und fördert die Kultur" zu ergänzen. Zimmermann monierte als vertane Chance, dass mit der neuen Regierungsvereinbarung wieder kein Bundeskulturministerium geschaffen wurde, das zur "Stärkung und Sichtbarmachung der Kultur" hätte beitragen können. Auch aus Sicht von Linken-Politiker Schliesing hat die Koalition mit der Streichung von Kulturförderung als Staatsziel und Verfassungssache aus dem Sondierungspapier der AG 14 vom März die Möglichkeit vergeben, die erforderlichen "politische(n) und juristische(n) Instrumente" zu schaffen, um "Kulturpolitik auf Augenhöhe" zu betreiben.
Lindh: „Überfälliger Strukturwandel der Erinnerungskultur“
Im von den Regierungspartner:innen angekündigten Restitutionsgesetz, der nach Maßgabe des gemeinsamen Vertrages zu erweiternden Provenienzforschung und zu stärkenden Gedenkstättenarbeit sieht Lindh einen "überfällige(n) Strukturwandel in der Erinnerungskultur" eingeleitet, der auch das Aufarbeiten kolonialer Geschichte und eine Politik gerechter Rückgaben einbeziehe. Linken-Politiker Schliesing hob die Pläne zur Herkunftsforschung und zum Rückgabegesetz als positiv hervor, beklagte jedoch mangelnde Details zur Realisierung. Er bemängelte, in der Vereinbarung seien viele wichtige, von der Kultur-AG herausgearbeitete Vorhaben weggefallen, wie die Einrichtung einer Enquete-Kommission zu "Demokratiebewusstsein durch Erinnerung an Diktatur und Unrecht".
Bei der Erinnerungspolitik habe man von vornherein zahlreiche Projekte nicht im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wie die Umsetzung des vom Parlament beschlossenen Baus eines Dokumentationszentrums zum Zweiten Weltkrieg und zur deutschen Besatzungsherrschaft in Europa sowie des Deutsch-Polnischen Hauses. Sie werden nach Angaben des BKM dennoch fortgesetzt. Schliesing räumte aber zugunsten des Kulturkapitels ein, es widme sich in einem Abschnitt dem Erinnern an Nationalsozialismus, Kolonialismus und SED-Diktatur, die Konzeption des Bundes zur Gedenkstättenförderung habe die Koalition vor, an neue Herausforderungen anzupassen. Es fehlten allerdings nähere Erläuterungen zum intensiveren Bewältigen des Kolonialismus, auch würden die Aufarbeitung von NS-Verbrechen an sog. Berufskriminellen und Asozialen sowie die Erinnerung an die NS-Euthanasie-Opfer nicht erwähnt.
Linke: Bei Filmförderreform bleibt Finanzierung unklar
Die Grünen-Kulturpolitikerin Tesfaiesus befürwortet, dass der Koalitionsvertrag wichtige kulturpolitische Schwerpunkte der Vorgängerregierung, wie die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) und des Filmfördergesetzes, Bundesprogramme wie Aller.Land oder Anerkennung der Clubkultur weiterführe. Beim Urheberrecht setzt die Koalition nach Ansicht von SPD-Politiker Lindh auf "fairen Interessenausgleich", indem Kreative, wenn ihre Werke z.B. durch Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden, eine angemessene Vergütung erhalten oder Internet-Portale Transparenz herstellen und Einnahmen gerecht teilen.
Die anvisierte nächste Stufe der Filmreform mit Steueranreizen für Produzent:innen und u.a. für Streamingdienste verpflichtenden Investitionen bietet nach Auffassung des SPD-Kultursprechers "große Chancen für den Filmstandort Deutschland", die Clubkultur als "schützenswerte(n) Bestandteil" des Kulturlebens zu legitimieren, sei ein längst gebotener Schritt. Insgesamt gelte es nun, die ambitionierten Vorhaben mit den nötigen Finanzmitteln, eindeutigen Gesetzesregelungen und im Dialog mit Vertreter/innen der Kulturszene zu verwirklichen. Der Linken-Abgeordnete Schliesing bewertet die von den Koalitionsparteien in Aussicht gestellte Filmreform und zuverlässige Förderung von Investitionen für Kinos ebenfalls als günstig, suspekt erscheint ihm aber, dass sie sich im Vertrag nicht zur Finanzierung durch den Bund und deren unerlässlicher Aufstockung im Gesamtrahmen der Reform äußern.
DK: Kulturstaatsminister bei Gleichstellungsstrategie beteiligen
Zum Thema Gleichstellung bemerkte der DK-Geschäftsführer, der Ausbau der Finanzierung von "spezielle(n) Förderungen für Gründerinnen" habe die "spezifischen Anforderungen der Kulturwirtschaft" zu beachten. Als zentral sieht es Zimmermann an, den BKM bei der - alle Ressorts übergreifenden - Gleichstellungsstrategie zu beteiligen, damit die "besondere(n) Belange() von Frauen in Kultur und Medien" entsprechend zur Kenntnis genommen werden. Wie Zimmermann vom DK, der dem Kulturteil der Vereinbarung trotz richtiger Vorhaben fehlenden Gestaltungswillen attestiert, vermisst die Grünen-Politikerin Tesfaiesus "eigene Akzente" der Regierungspartner:innen. Vieles "wirkt vage und bleibt floskelhaft", kritisierte sie gegenüber dem zwd. Kunstfreiheit werde deklaratorisch hervorgehoben, ohne das zu konkretisieren, z.B. wie über "rechtssichere Förderrichtlinien" zu gewährleisten ist, dass der Bund keine Projekte mit antisemitischen, rassistischen oder anderen menschenverachtenden Tendenzen unterstützt.
Grüne: Anpassung von Gagen an steigende Kosten nicht garantiert
Lindh unterstützt den Vorsatz, in den Kulturförderprogrammen Mindestgagen und Untergrenzen für Honorare auch in der neuen Legislatur verbindlich zu berücksichtigen. .Dem Linken Schliesing sind die Absichtserklärungen der Koalition zu den Mindestgagen und -honoraren nicht präzise genug, darüber hinaus habe die Koalition die Rolle von Kulturakteur:innen und Institutionen an Entscheidungsprozessen völlig ignoriert. Tesfaiesus gibt bei den im Kontext der Bundesförderung einzuhaltenden Untergrenzen für Künstle:innen-Löhne zu bedenken, dies müsse man auf die Formulierung beziehen, man werde die Finanzmittelvergabe an die Bundeskulturfonds stabilisieren. Angesichts der Inflation könne man das nur in der Art verstehen, dass die Gagen und Honorare voraussichtlich nicht an erwartungsgemäß steigende Kosten angepasst würden. Das sei "keine Bestandssicherung, sondern ein Rückschritt".
DK wird sich in Strategie Kultur und KI einmischen
Nach Auffassung von Tesfaiesus haben SPD und Union Herausforderungen durch KI oder Urheberrechte nicht hinreichend genau bestimmt. Es bleibe sowohl "völlig offen", wie das herausgestellte Potenzial von KI und das angemahnte Respektieren von Urheberrechten miteinander zu vereinbaren sind, als auch wie die geplante "Strategie Kultur & KI" inhaltlich ausgefüllt ist. Auch für DK-Geschäftsführer Zimmermann wird nicht deutlich, was mit dem gemeinsamen Bund-Länder-Konzept zur KI gemeint sei und inwieweit diese Strategie in die Bemühungen zur Digitalisierung eingebunden werde. KI spielt bei Digitalisierung nach Aussagen von Zimmermann "selbstverständlich (...) eine wesentliche Rolle". Daher empfiehlt er, die "Expertise des gesamten Kulturbereichs in die Überlegungen zu Kultur und KI einzubeziehen", der DK werde sich "in die Erarbeitung der ´Strategie Kultur und KI´" einmischen. Außerdem schlägt Zimmermann vor, den Kulturbereich in die Experten-Kommission zu Wirtschaft und KI einzubinden.
Kritik von Grünen und Linken: Kaum Projekte kultureller Teilhabe
Dem KulturPass, der von der Koalition "mit einem Prüfauftrag versehen" sei, bescheinigt DK-Geschäftsführer Zimmermann "sicherlich noch Potenziale", wenn dessen stärker wirtschaftliche Ausrichtung, mehr Publikum mit Angeboten von Kulturinstitutionen und – unternehmen zu erreichen, "enger mit dem Gedanken der Teilhabe verbunden" werde. Was kulturelle Partizipation betrifft, missbilligen die grüne Kulturpolitikerin Tesfaiesus und ihr Kollege von den Linken, diese werde fast ganz auf die ländliche Regionen eingeschränkt. "Von Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und anderen Teilhabeaspekten" fehle jedes Anzeichen, so die Politikerin, Schliesing fordert Beteiligung besonders für "einkommensschwache Gruppen". Tesfaiesus wirft den Regierungspartner/innen vor, statt eindeutige Bekenntnisse abzugeben, würden sie auf Kultur-Sponsoring, Mäzenatentum, Wirtschaftskooperationen verweisen. Dass das Staatsziel Kultur nicht im GG verankert werden soll, liegt für sie auf der gleichen Linie.
Schliesing übt daran Kritik, dass der Koalitionsvertrag zwar etablierte Strukturen formal bestätige, umgekehrt in der Frage unkonkret bleibe, wie diese mittel- oder längerfristig zu finanzieren und zu fördern seien. Der ganze Vertrag sei von Ideen der "Effizienzsteigerung, Digitalisierung und Public-Private-Partnerships" geprägt, durch Kulturpolitik künstlerisch-kulturelles Schaffen Marktgesetzen zu unterwerfen, stünde allerdings im Widerspruch zu der beschworenen gesellschaftlichen Relevanz von Kultur und Kunstfreiheit. Als essenziell für die Politik schätzt es Tesfaiesus ähnlich wie Schliesing ein, dass die Koalitionspartner/innen alle Maßnahmen "unter Finanzierungsvorbehalt" stellen. Für den linken Kulturfachmann wird dadurch das sowieso begrenzte Kulturbudget in Höhe von 2,2 Mrd. Euro in Zweifel gezogen, außerdem sei unklar, wie im kooperativen Föderalismus die "Bundeskulturpolitik (...) mehr als eine Ergänzung der Kulturhoheit der Länder" sein könne.