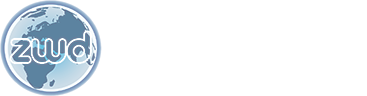zwd Berlin. In ihrem Debattenbeitrag für das zwd-POLITIKMAGAZIN unterstrich die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Evelyne Gebhardt (SPD), dass ein verpflichtendes Europäisches Jahr das „beste Serum gegen den nationalistischen Virus“ sei. Es könne nachrückenden Generationen ermöglichen, Europa wahrhaftig zu erfahren und interkulturelle, sprachliche und soziale Kenntnisse zu erwerben.
Das SPD-Vorstandsmitglied Wiebke Esdar (MdB) plädierte dafür, ein verpflichtendes Europäisches Jahr in die Schulzeit einzubinden. So könne es pädagogisch begleitet werden und es könne darüber hinaus verhindert werden, dass der Staat in die freie Berufswahl und Lebensplanung der Einzelnen eingreife.
Vertreter*innen der anderen Parteien bewerteten den Vorschlag Pohls dagegen in ihren Statements zurückhaltend. Die Vizepräsidentin des Kultur- und Bildungsausschusses im Europäischen Parlament, Helga Trüpel (Grüne), begrüßte zwar die Idee, sieht aber keine Realisierungschancen. Die rechtlichen Hürden in den einzelnen Mitgliedsstaaten seien - wie auch in Deutschland - sehr hoch.
Der Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik der Linken-Bundestagsfraktion, Norbert Müller, forderte einen Ausbau der derzeit vorhandenen Jugendfreiwilligendienste, damit alle, die ihn absolvieren wollten, die Möglichkeit dazu erhalten, unabhängig von ihrer finanziellen Situation.
Gyde Jensen (FDP), MdB seit 2017, und Dennis Radtke (CDU), Mitglied im Ausschuss Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im Europäischen Parlament, bewerteten die Idee für ein Europäisches Jahr zwar positiv, kritisierten jedoch den Verpflichtenden Charakter des Vorschlages.
Grundlage für die Debattenfrage war die Präsentation des Buchs „Ein JA muss sein“, in dem Pastor Pohl, Chef des größten Sozialunternehmens in Europa, das Projekt ASJ vorgestellt und Vorschläge für seine Realisierbarkeit erläutert hatte.
Die Statements im Einzelnen:
Evelyne Gebhardt MdEP/SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mitglied der S&D-Fraktion:
"Ein verpflichtendes Europäisches Jahr wäre das beste Serum gegen den nationalistischen Virus. Es könnte nachrückenden Generationen gelingen, Europa wahrhaftig zu erfahren."
 Entscheidend für den dauerhaften Erfolg unseres Europäischen Projektes wird nicht die Frage sein, wie Handelsverträge mit Drittstaaten im Einzelnen ausgestaltet sind und schon gar nicht, ob wir zur Sommerzeit in Europa die Uhren zurückstellen müssen oder nicht. Das einzig dauerhafte Fundament der Europäischen Union besteht in der (Weiter-) Entwicklung unserer Europäischen Identität, also unseres Bewusstseins, ob und wie wir uns selbst als Europäer und Europäerinnen begreifen. Für die Schaffung einer solchen Identität müssen wir insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit einräumen, die Vielfalt Europas erleben zu können. Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, schlug deshalb etwa vor, jedem Jugendlichen zu dessen 18. Geburtstag ein Interrailticket zu schenken. Die Idee mag vordergründig durchaus Charme haben, doch würden wir jungen Menschen damit allenfalls die Chance bieten, Europa touristisch zu besichtigen. Mittels eines Europäischen Jahres könnte es nachrückenden Generationen dagegen gelingen, Europa wahrhaftig zu erfahren, es mitzugestalten und gleichzeitig eigene soziale Kompetenzen zu fördern. Damit wäre ein verpflichtendes Europäisches Jahr, der damit verbundene
Erwerb interkultureller, sprachlicher, sozialer Kenntnisse sowie das
positive Erlebnis eines gemeinsam umgesetzten Projekts das beste Serum
gegen den nationalistischen Virus, der derzeit in Europa grassiert.
Entscheidend für den dauerhaften Erfolg unseres Europäischen Projektes wird nicht die Frage sein, wie Handelsverträge mit Drittstaaten im Einzelnen ausgestaltet sind und schon gar nicht, ob wir zur Sommerzeit in Europa die Uhren zurückstellen müssen oder nicht. Das einzig dauerhafte Fundament der Europäischen Union besteht in der (Weiter-) Entwicklung unserer Europäischen Identität, also unseres Bewusstseins, ob und wie wir uns selbst als Europäer und Europäerinnen begreifen. Für die Schaffung einer solchen Identität müssen wir insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit einräumen, die Vielfalt Europas erleben zu können. Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, schlug deshalb etwa vor, jedem Jugendlichen zu dessen 18. Geburtstag ein Interrailticket zu schenken. Die Idee mag vordergründig durchaus Charme haben, doch würden wir jungen Menschen damit allenfalls die Chance bieten, Europa touristisch zu besichtigen. Mittels eines Europäischen Jahres könnte es nachrückenden Generationen dagegen gelingen, Europa wahrhaftig zu erfahren, es mitzugestalten und gleichzeitig eigene soziale Kompetenzen zu fördern. Damit wäre ein verpflichtendes Europäisches Jahr, der damit verbundene
Erwerb interkultureller, sprachlicher, sozialer Kenntnisse sowie das
positive Erlebnis eines gemeinsam umgesetzten Projekts das beste Serum
gegen den nationalistischen Virus, der derzeit in Europa grassiert.
Dr. Wiebke Esdar (MdB/SPD) und Julius Wentland (FSJ'ler):
"Ein in die Schulzeit eingebundenes, europaweit verpflichtendes soziales Jahr wurde einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in Europa leisten. Das Jahr könnte vor- und nachbereitet sowie pädagogisch begleitet werden."
Um die Vorteil e eines verpflichtenden Sozialen Jahres voll
ausschöpfen zu können, ist es notwendig, dieses auf europäische Füße zu
stellen. Hierbei sind Zeitpunkt und Durchführung von großer Relevanz. Die durch
ein europäisches Soziales Jahr geförderte kulturelle Verständigung, Toleranz,
Weltoffenheit, der Abbau von Vorurteilen und die gelebte Solidarität können
eine wirkliche europäische Identität erschaffen und so eine tatsächliche,
belastbare Wertegemeinschaft in der EU entstehen lassen. Unser Vorschlag: Ein
in die Schulzeit eingebundenes, europaweit verpflichtendes soziales Jahr würde
einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in Europa leisten. Durch Einbindung
in die Schulzeit könnte das Jahr vor- und nachbereitet sowie pädagogisch begleitet
werden. Die Lehrer könnten zusätzlich bei der Entscheidungshilfe und bei dem
Bewerbungsprozess unterstützend agieren. Somit wäre eventuell auch eine
Verkürzung des Jahres auf sechs oder neun Monate denkbar, die restliche Zeit
des Jahres würde durch den Unterricht in vorher genannter Weise gefüllt werden.
Durch diese Organisation würde der Staat nicht in die freie Berufswahl und die
Lebensplanung des Einzelnen eingreifen und ein geregelter Ablauf wäre
garantiert.
e eines verpflichtenden Sozialen Jahres voll
ausschöpfen zu können, ist es notwendig, dieses auf europäische Füße zu
stellen. Hierbei sind Zeitpunkt und Durchführung von großer Relevanz. Die durch
ein europäisches Soziales Jahr geförderte kulturelle Verständigung, Toleranz,
Weltoffenheit, der Abbau von Vorurteilen und die gelebte Solidarität können
eine wirkliche europäische Identität erschaffen und so eine tatsächliche,
belastbare Wertegemeinschaft in der EU entstehen lassen. Unser Vorschlag: Ein
in die Schulzeit eingebundenes, europaweit verpflichtendes soziales Jahr würde
einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in Europa leisten. Durch Einbindung
in die Schulzeit könnte das Jahr vor- und nachbereitet sowie pädagogisch begleitet
werden. Die Lehrer könnten zusätzlich bei der Entscheidungshilfe und bei dem
Bewerbungsprozess unterstützend agieren. Somit wäre eventuell auch eine
Verkürzung des Jahres auf sechs oder neun Monate denkbar, die restliche Zeit
des Jahres würde durch den Unterricht in vorher genannter Weise gefüllt werden.
Durch diese Organisation würde der Staat nicht in die freie Berufswahl und die
Lebensplanung des Einzelnen eingreifen und ein geregelter Ablauf wäre
garantiert.
Dr. Helga Trüpel MdEP/Grüne, Mitglied der EFA:
"Die Grundidee ist begrüßenswert, die Umsetzung eines 'verpflichtenden Sozialdienstes' in der EU jedoch höchst unrealistisch."
Angesichts des stärker werdenden Euroskeptizismus in Europa
muss der Solidaritätsgedanke gerade bei jungen Menschen frühestmöglich
gefördert we rden. Die Grundidee eines sozialen Jahres für Jugendliche auf
europäischer Ebene ist prinzipiell begrüßenswert, die Umsetzung eines
„verpflichtenden Sozialdienstes“ in der EU jedoch höchst unrealistisch. Nicht
nur in Deutschland sind die Hürden einer Verfassungsänderung, die für die
Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres erforderlich wären, sehr hoch.
In den anderen EU-Staaten dürfte es sich ähnlich gestalten. Die
Entscheidungskompetenzen in der Jugend-und Bildungspolitik liegen zudem
eindeutig bei den Mitgliedsstaaten. Die EU hat in diesen Politikbereichen nur
ergänzende Zuständigkeiten. Trotzdem versucht die EU-Kommission Antworten auf
das Auseinanderdriften der Europäischen Union zu finden. Vor diesem Hintergrund
wurde eine wertvolle Initiative auf den Weg gebracht, das Europäische
Solidaritätskorps (ESK). Als Berichterstatterin dieses Programms im Europäischen
Parlament möchte ich den Wert des Freiwilligendienstes auf europäischer Ebene
stärken und einen verschärften Fokus auf Inklusion legen. Gerade benachteiligte
junge Menschen sollen eine Chance bekommen, sich im Inland oder im Ausland
sozial oder kulturell engagieren zu können. Auch wenn es keine Verpflichtung
für junge Leute gibt, an der Initiative teilzunehmen, ist die Nachfrage groß
und somit auch die Hoffnung, den Zusammenhalt in Europa zukünftig wieder zu
stärken.
rden. Die Grundidee eines sozialen Jahres für Jugendliche auf
europäischer Ebene ist prinzipiell begrüßenswert, die Umsetzung eines
„verpflichtenden Sozialdienstes“ in der EU jedoch höchst unrealistisch. Nicht
nur in Deutschland sind die Hürden einer Verfassungsänderung, die für die
Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres erforderlich wären, sehr hoch.
In den anderen EU-Staaten dürfte es sich ähnlich gestalten. Die
Entscheidungskompetenzen in der Jugend-und Bildungspolitik liegen zudem
eindeutig bei den Mitgliedsstaaten. Die EU hat in diesen Politikbereichen nur
ergänzende Zuständigkeiten. Trotzdem versucht die EU-Kommission Antworten auf
das Auseinanderdriften der Europäischen Union zu finden. Vor diesem Hintergrund
wurde eine wertvolle Initiative auf den Weg gebracht, das Europäische
Solidaritätskorps (ESK). Als Berichterstatterin dieses Programms im Europäischen
Parlament möchte ich den Wert des Freiwilligendienstes auf europäischer Ebene
stärken und einen verschärften Fokus auf Inklusion legen. Gerade benachteiligte
junge Menschen sollen eine Chance bekommen, sich im Inland oder im Ausland
sozial oder kulturell engagieren zu können. Auch wenn es keine Verpflichtung
für junge Leute gibt, an der Initiative teilzunehmen, ist die Nachfrage groß
und somit auch die Hoffnung, den Zusammenhalt in Europa zukünftig wieder zu
stärken.
Gyde Jensen MdB/FDP:
"Dem Vorstoß, das soziale oder ökologische Jahr auf eine europäische Perspektive auszuweiten, kann ich mich nur anschließen. Dem verpflichtenden Charakter stehe ich jedoch kritisch gegenüber."

Ein soziales oder ökologisches Jahr ist eine fabelhafte
Lösung, um jungen Menschen nach dem Schulabschluss neue Impulse für den eigenen
Berufs- und Lebensweg aufzuzeigen. Das Engagement hilft dabei, eigene
Kenntnisse und Fähigkeiten besser einzuschätzen und ist nicht nur eine
Bereicherung im Sinne des Gemeinwohls, sondern auch für das eigene Leben. Dem Vorstoß,
das soziale oder ökologische Jahr auf eine europäischer Perspektive
auszuweiten, kann ich mich nur anschließen. Ich bin Teil der Generation, für
die ein grenzenloses Europa der unendlichen Chancen Normalität ist. Europa ist
unsere Zukunft. Eine Nebensäule zum erfolgreichen Erasmus-Programm würde die
Verwirklichung und Erlebbarkeit der europäischen Idee für noch mehr junge
Menschen zugänglich machen. Dem verpflichtenden Charakter des sozialen oder
ökologischen Jahres stehe ich jedoch kritisch gegenüber. Ich glaube an die
persönliche Freiheit für jeden Einzelnen und denke, dass ein Zwang der
Bedeutung und dem Wert der Idee von Eigeninitiative, Mitgestaltung und
Beteiligung nicht gerecht wird. Daher befürworte ich die Fortführung der
jetzigen Praxis der Jugendfreiwilligendienste, die jährlich schon über 60.000
Jugendliche in gemeinnützigen Einrichtungen, im Natur- und Umweltschutz oder in
Hilfsprojekten im Ausland nutzen.
Norbert Müller MdB/Linke:
„Wir wünschen uns einen Ausbau der derzeit vorhandenen
Jugendfreiwilligendienste, damit alle, die einen solchen Dienst absolvieren
wollen, die Möglichkeit dazu erhalten – unabhängig von ihrer finanziellen
Situation.”

Die Idee eines verpflichtenden sozialen Jahres nach
Schulabschluss sehen wir skeptisch. Nicht nur, dass es damit das freiwillige
soziale Jahr (FSJ) sowie das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) ersetzen würde.
Die beiden Freiwilligendienste sind in Deutschland so erfolgreich, weil
Jugendliche sich frei dazu entscheiden können. Die Schulpflicht in Deutschland
ist nicht einheitlich geregelt, es ist also unklar, wann Schülerinnen und
Schüler diesen Dienst übernehmen müssten. Weiterhin müssten die vielen unterschiedlichen
Zuständigkeiten in der Bildungspolitikneu geklärt werden. Die größten Bedenken
hegen wir aber bei den Einsatzbedingungen für diese Jugendlichen. FSJ und FÖJ
sind Bildungs- und Orientierungsdienste, bei dem die Freiwilligen
unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten übernehmen und keine hauptamtlichen
Kräfte ersetzen. Dies müsste für die eine Million Jugendliche sichergestellt
werden. Auch wenn eine Stelle gerade noch nicht vorhanden ist und sie dann mit
einem Freiwilligen besetzt wird, ist die Arbeitsmarktneutralität nicht gegeben.
Um das Ganze auf europäische Füße zu stellen, müssten sich alle Länder über
Standards einigen, diese einhalten und Plätze zur Verfügung stellen. Wir
wünschen uns einen Ausbau der derzeit vorhandenen Jugendfreiwilligendienste,
damit alle, die einen solchen Dienst absolvieren wollen, die Möglichkeit dazu
erhalten – unabhängig von ihrer finanziellen Situation.
"Die europäische Identität könnte dadurch geförderet werden. Doch ist ein Pflichtjahr der richtige Ansatz?"

In einer ständig nach Effizienz strebenden Gesellschaft, in
welcher Selbstreflektion kaum mehr stattfindet, fragt man sich, wie man einer
solchen Entwicklung entgegenwirken kann. Die Idee eines Sozialjahres kann da
sinnvoll sein. Nicht nur der Gemeinsinn für unsere Gesellschaft würde gestärkt
werden – unter europäischer Ausweitung könnte dadurch sogar die europäische
Identität gefördert werden. Doch ist ein Pflichtjahr der richtige Ansatz? Solch
ein Projekt bedarf entsprechender Strukturen. Es muss zudem geprüft werden, ob
überhaupt genug Kapazität besteht. Für die bestehenden Programme eines FSJs
gibt es bereits eine größere Nachfrage als vorhandene Plätze. Zudem muss man
sich fragen: „Kann man Jugendliche gegen ihren Willen in ein anderes EU-Land
schicken, aufgrund der Gesetzgebung?“ Es wäre unverantwortlich dies zu tun,
denn das würde Demotivation und Unmut gegen soziale Arbeit hervorrufen. Auch
kann man Kranken und Pflegebedürftigen nicht zumuten, sich von unerfahrenen
Schülern betreuen zu lassen. Diese bringen oft nicht die nötige Reife mit, die
der Pflege- und Betreuungsbereich erfordert. Auch müssten Fachkräfte dann mit
den Sozialdienstleistenden um diese Jobs konkurrieren, was die Qualität der
Betreuung erheblich mindern würde. Generell bin ich der Überzeugung, dass ein
soziales Jahr gut sein kann, da man in einem solchen Jahr viel lernt und reift.
Ich selbst habe im Katastrophenschutz gearbeitet, was mich positiv geprägt hat.
Eine solche Erfahrung darf aber nicht erzwungen werden, sondern muss von jedem
Einzelnen selbst kommen.
Ausführliche Artikel von zwd-Chefredakteurin Hilda Lührig-Nockemann finden Sie hier zum ASJ und hier zum Freiwilligen Europäischen Sozialjahr.
Fotos: Evelyne Gebhardt, Dr. Wiebke Esdar, Dr. Helga Trüpel: jeweils eigene Homepage, Gyde Jensen: FDP, Norbert Müller: DIE LINKE, Dennis Radtke: CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament