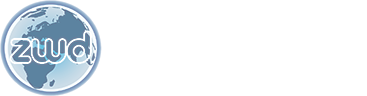zwd Berlin/ Straßburg. Zita Gurmai, Vertreterin der sozialistischen Gruppe (SOC) im Europarat aus Ungarn, sagte auf der Versammlung, die Konvention sei „das umfassendste und fortschrittlichste institutionelle gesetzliche Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“, das heutzutage als ein „universeller Maßstab“ eingesetzt werden könne. In ihrer Rede hob sie die seit seinem Inkrafttreten 2014 bisher durch das Übereinkommen erreichten „Errungenschaften und Erfolge“ hervor und unterstrich, dass es bereits eine „spürbare und positive Wirkung“ habe. Höhere politische und gesetzliche Normen, welche mehrere Mitgliedsländer in ihren innerstaatlichen Rechtssystemen eingeführt haben sowie ein größeres Bewusstsein für das Problem der sexualisierten Gewalt in der Bevölkerung und unter den Opfern zählten zu den praktischen Ergebnissen, welche man durch die Anwendung der Konvention erzielt habe. Dennoch haben bisher nicht alle Staaten das Übereinkommen ratifiziert bzw. unterzeichnet, und strittige Fragen beeinträchtigen seine Umsetzung durch die Vertragspartner.
Gemeinsames Handeln von Politik, Gesetzgebung und Institutionen erforderlich
Die Mitglieder von PACE beklagten, dass in vielen Fällen immer noch eine große Kluft zwischen den in dem Völkerrechtsvertrag festgeschriebenen Rechtsnormen und ihrer Einhaltung bestünde. In einer Resolution (2289) machten die Abgeordneten von PACE deutlich, dass ein gemeinsames Handeln von Politik, Gesetzgebung und Institutionen notwendig sei, um Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen. Das Anwenden von Gewalt gegen Frauen in ihren vielen verschiedenen Formen geißelten die PACE-Mitglieder als ein Verbrechen, das in keiner Weise erlaubt sei zu rechtfertigend oder zu rationalisieren. Es bezeichneten es gleichzeitig als eine geschlechtsspezifische Diskriminierung und als Ausdruck einer „tief verwurzelten Ungleichheit zwischen Frauen und Männern“.
Die PACE-Mitglieder betonten, dass sexualisierte Gewalt unabhängig vom sozialen Status der Täter wie der Opfer auftrete und dass kein Land auf der Welt davor gefeit sei. Jede dritte Frau innerhalb der Europäischen Union würde einmal oder mehrfach in ihrer Lebenszeit Opfer einer geschlechtsspezifischen Gewalttat. Daher forderten die Abgeordneten der Versammlung die übrigen Mitgliedsstaaten auf, das Übereinkommen ohne weitere Verzögerung zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Gleichermaßen sollten die Vertragsparteien die Anmerkungen und Vorschläge der Expertengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO) berücksichtigen und bei der Verwirklichung der von der Konvention formulierten Richtlinien die Empfehlungen des Ausschusses der Vertragspartner zu befolgen. Bislang haben von den insgesamt 47 im Europarat vertretenden Ländern 33 die Konvention ratifiziert, 11 haben sie nur unterschrieben. Zuletzt trat die Republik Irland am 08.März 2019 dem Übereinkommen bei, nur die Russische Föderation und Aserbaidschan haben sich noch nicht offiziell zu seinen Grundsätzen bekannt. Zu den wichtigsten Aufgaben des Europarates gehört es, die Menschenrechte zu schützen, die pluralistische Demokratie zu verteidigen und über die Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien zu wachen.
Ohne geschützte Menschenrechte für Frauen gibt es keine Demokratie
Anlässlich des 70. Jahrestages seiner Gründung bekannten sich die Abgeordneten von PACE außerdem zu der von dem Menschenrechtsgremium entworfenen „Strategie zur Gleichheit der Geschlechter 2018 – 2023“, welche im Kontext von Wirtschaftslage und politischer Einflussnahme die Ziele und vorrangigen Anliegen beim Kampf um die Gleichberechtigung umreißt und sich u.a. gegen überkommene Geschlechter-Stereotype und Sexismus sowie Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wendet, sich für den nicht-diskriminativen Zugang von Frauen zu Gerechtigkeit, Teilhabe an Politik und öffentlichen Entscheidungen einsetzt sowie ein allgemeines „Gender Mainstreaming“ bei allen staatlichen Vorgehensweisen und Maßnahmen anstrebt.
„Solange Frauen und Männer nicht dieselbe Ermächtigung, Teilhabe, Sichtbarkeit und Zugang zu Ressourcen genießen, können wir nicht behaupten, dass Menschenrechte, Demokratie oder die Herrschaft des Gesetzes geachtet würden“, erklärte Elvira Kovacs, Mitglied des Europarates (Europäische Volkspartei EVP/ CD) aus Serbien. Gleichheit der Geschlechter sei ein zentrales Anliegen des Europarates. Ohne Menschenrechte, Demokratie und Frieden sei es laut Kovacs unmöglich, eine „institutionelle Infrastruktur für Geschlechtergleichheit“ aufzubauen, andererseits gebe es ohne anerkannte und geschützte Menschenrechte für Frauen auch keine Demokratie. Der Europarat sei einschließlich seiner Parlamentarischen Versammlung seit Jahrzehnten eine treibende Kraft dabei, der Diskriminierung gegen Frauen entgegenzutreten und habe bei seinen Mitgliedsstaaten einen wesentlichen Fortschritt gefördert, sagte die PACE-Abgeordnete. Trotzdem sei Gleichheit der Geschlechter in der Praxis noch lange nicht erreicht. Kovacs stellte fest, dass ein Rückschlag gegen Frauenrechte den erreichten Fortschritt gefährde. Das erfordere erneute Anstrengungen des Europarates, bei denen ein Wandel in den Geisteshaltungen, politischer Wille und Engagement die Voraussetzungen für einen soliden, langanhaltenden Fortschritt bilden.
Weltweiter Rückschlag gegen die Rechte von Frauen
In einer eigenen Resolution (2290) forderte die PACE-Versammlung das Komitee der Außenminister*innen dazu auf, weitere Mechanismen zur Realisierung der Gleichheit der Geschlechter anzuwenden und verlangten, dass der Europarat diese mit einem anspruchsvollen Programm voranbringen solle. Schon auf einer im Mai in Straßburg vom Europarat organisierten Konferenz zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit beim Kampf gegen Gewalt gegen Frauen hatte Marlène Schiappa, die Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter in Frankreich, das gegenwärtig den Vorsitz im Europarat innehat, einen mit allen Mitteln einzudämmenden Rückschlag gegen die Rechte von Frauen verkündet und die europäischen Partnerstaaten aufgerufen, „Frauen in allen Ländern und auf allen Ebenen“zu schützen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen. „Ich glaube, es ist unmöglich, für berufliche Gleichberechtigung und für den Platz von Frauen im öffentlichen und politischen Leben zu kämpfen, wenn man nicht gegen sexistische und sexuelle Gewalt gegen Frauen kämpft“, sagte sie auf der Konferenz.
Alle Länder in der EU und darüber hinaus sollten die Istanbul-Konvention ratifizieren und sich an deren Umsetzung beteiligen. Dazu gehöre es auch, falsche Einschätzungen und vorgetäuschte, fehlerhafte Argumente und Überzeugungen hinsichtlich des Übereinkommens zu widerlegen, Gegendarstellungen zu verbreiten und auf solche gezielten Kampagnen gegen Frauenrechte und Gleichberechtigung zu reagieren. Sie stellte heraus, dass „einige der wichtigsten Demokratien in der westlichen Welt … in wichtigen Punkten wieder auf Frauenrechte und die öffentliche Debatte darüber“ zu sprechen kommen und beispielsweise das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Frage stellen. „Kein Land kann hoffen, umfassende Gleichheit allein zu erreichen, wir müssen zusammenarbeiten“, sagte sie in ihrer Stellungnahme. Im Mittelpunkt der Tagung stand die Arbeit des Expertenforums GREVIO und seine Maßnahmen zur wirksamen Koordinierung der weltweiten Anstrengungen im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, welche auch ein Hindernis für die Gleichstellung der Geschlechter darstellt. Weiterhin verhandelten die Teilnehmer*innen aus aller Welt aktuelle Themen aus dem Feld von Gewalt gegen Frauen wie das vielfach zu schwerwiegenden Streitfällen führende Kinder-Sorgerecht und der Umgang mit häuslicher Gewalt in der internationalen Rechtsprechung oder die Frage, inwiefern die Gleichberechtigung von Frauen und Männern dabei unterstützend wirken könne, die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der Agenda 2030 zu verwirklichen.