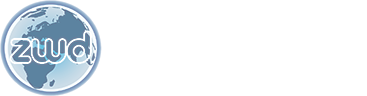zwd Berlin. Pünktlich acht Jahre nach Inkrafttreten des ProstSchG hat die Bundesregierung den verpflichtenden Evaluationsbericht zu dessen Folgewirkungen vorgelegt. In ihrer Stellungnahme zum am 04. Juli im Bundestag als Unterrichtung (Drs. 21/ 700) veröffentlichten Studie resümiert die Regierung, diese zeige „sowohl die Stärken als auch die Schwächen“ des Gesetzes auf. Die Erkenntnisse und Empfehlungen könnten „als eine datenbasierte Grundlage für die weitere politische Diskussion des Themas“ dienen, eine inhaltliche Beurteilung behält sich die Koalition jedoch vor. Die Resultate könnten dafür herangezogen werden, über Änderungen beim Anwenden der Regelungen oder „mögliche Gesetzesänderungen im Bereich der Prostitution“ zu entscheiden. Wie Destatis am 03. Juli meldete, stieg die Zahl registrierter Sexarbeiter:innen zum Dezember 2024 auf 32.300, 5,3 Prozent mehr als 2023, befand sich aber immer noch unter dem Niveau von vor der Pandemie (2019: 40.400). Demgegenüber verringerten sich die amtlich genehmigten Prostitutions-Gewerbe mit 2.250 um 2,6 Prozent (2023: 2.310).
Prien: Schutz vor Zwang und sexueller Ausbeutung wichtig
Bundesfrauenministerin Prien betonte anlässlich der Übermittlung der Evaluation an das Parlament am 24. Juni, „Schutz vor Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung wie auch die Rechte der Betroffenen“ seien „wichtige Aufgaben, mit denen sich dieses Ministerium intensiv beschäftigt“. Prien kündigte an, eine „unabhängige Expertenkommission“ einzusetzen, um mittels der Ergebnisse die Ziele so gut wie möglich zu erreichen. Das Bundesfamilienministerium (BMBFSFJ) teilte mit, die Kommission werde sich konkreten Ergebnissen des Berichtes als auch „grundsätzlichen Fragen zur Situation der Prostituierten“ in der Bundesrepublik widmen.
KFN: Anmeldeverfahren informiert über Rechte und Risiken
Die Mitarbeiter:innen des vom Familienministerium mit der Evaluation beauftragten Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) stellen fest, das ProstSchG habe „durchaus beachtliche Erfolge“ vorzuweisen, es gebe Anhaltspunkte, dass dessen Zwecke „zu einem erheblichen Teil“ verwirklicht seien. Was das obligatorische Anmeldeverfahren betrifft, würde vieles dafür sprechen, dass es dadurch tatsächlich gelinge, „Prostituierte (…) über ihre Rechte zu informieren, sie über gesundheitliche Risiken (…) aufzuklären“ sowie ihnen Optionen zu eröffnen, „in schwierigen Lebenslagen Unterstützung zu erhalten“. Ebenso nehmen die Forscher:innen auf der Datenbasis der Studie an, dass sich sowohl die Arbeitsbedingungen von Prostituierten in erlaubten Sexkauf-Betrieben als auch die Möglichkeiten verbessert haben, solche Geschäfte staatlich zu überwachen.
Das KFN führte seit dem 1. Juli 2022 neben Analysen von Forschungsliteratur und Statistiken u.a. 55 Expert:innen-Interviews und quantitative Online-Befragungen mit 6.928 Personen durch, darunter 2.350 Prostituierte, 284 Gewerbetreibende, 824 Sachbearbeiter:innen und 3.470 Kund:innen. Die Resultate sind nach Angaben der Forscher:innen für die Gruppen aussagekräftig. Insgesamt leiten sie 64 Empfehlungen und Prüfvorschläge aus den Ergebnissen der Untersuchung ab, z.B. zum Schutz von Anmeldedaten oder zur auskömmlicher Finanzierung von anerkannten Beratungsstellen. Das ProstSchG trat am 1. Juli 2017 in Kraft und beinhaltet in erster Linie eine neu eingeführte Anmeldepflicht und regelmäßige gesundheitliche Beratung für Prostituierte, für das Sexkaufgewerbe ein verbindlich zu durchlaufendes Erlaubnisverfahren, wobei bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen sind.
Neuer Trend: Digitale Prostitutionsportale immer bedeutsamer
Angesichts des neuen Trends, wonach das Feld der digitalen Prostitutionsportale in den vorigen Jahren spürbar an Bedeutung zugenommen hat, geben die KFN-Mitarbeiter:innen zu bedenken, ob die bisher nicht der Erlaubnispflicht unterliegenden Sexkaufportale ebenfalls verbindlich in das Verfahren aufzunehmen seien. Durch die Verschiebung in die digitale Domäne dürfte es umgekehrt für Fachberatungsstellen schwieriger werden, Zugang zu ihren in der Prostitution arbeitenden Klient:innen zu finden. Aus Sicht der Forscher:innen ließe sich die Effektivität des Gesetzes erheblich steigern, wenn man einige Schwächen beheben würde. U.a. halten sie die Akzeptanz des Verfahrens zur Anmeldung für verbesserungsfähig, da sich Prostitution ausübende Personen nur teilweise offiziell registrieren.
Forscher:innen: Prostituierte vor Alltags-Diskriminierung schützen
Als Hauptgrund vermutet der Bericht die mangelnde Bereitschaft, die Tätigkeit gegenüber einer staatlichen Behörde offenzulegen, wegen des „häufigen Benachteiligungserlebens“ seien viele Prostituierte diesbezüglich zurückhaltend und würden ihre Arbeit vor anderen verheimlichen. Die Verfasser/innen der Studie kritisieren, das Gesetz berücksichtige keine „wirkungsvolle(n) Ansätze“, um „(…) den gesellschaftlichen Blick auf Prostitution zu verändern“. Sie fordern im Falle einer Überarbeitung des Gesetzes, finanziell solche Maßnahmen zu fördern, die über Sexarbeit aufklären und verdeutlichen, „dass es sich um einen verfassungsrechtlich anerkannten und daher auch gesellschaftlich anzuerkennenden Beruf handelt“. Allgemein sollte man nach Auffassung des KFN im Gesetz Hilfen "individuell an die spezifischen Lebensrealitäten" der unterschiedlichen Gruppen anpassen
Darüber hinaus schlagen sie vor, Schritte zu prüfen, wodurch man „Diskriminierung (…) von Prostituierten im Alltag“ entgegenwirken könnte. Potenziale, das Anmeldeverfahren zu wirksamer zu machen, erkennt das KFN auch in der Schulung von Behörden-Mitarbeiter:innen. Einem beträchtlichen Anteil von ihnen fehle eine spezifische Weiterbildung, stattdessen solle man ein verpflichtendes Angebot zu Anmeldung und gesundheitlicher Beratung etablieren. Dabei solle man erfahrene Sexarbeiter:innen und Gewerbetreibende einbeziehen, da Prostituierte in den Interviews vielfach beklagt hätten, Sachbearbeiter:innen würden partiell nicht über Kenntnisse zur Realität von Prostitution verfügen.
Hohe Rate an sexueller Belästigung und mehrfache Viktimisierung
In Hinsicht auf die Erlaubnispflicht von Sexkauf-Betrieben hätten die Befragungen ergeben, dass die Verfahren teilweise zeitlich sehr aufwendig seien und mehr als ein Jahr bis sieben Jahre dauerten. Außerdem seien die Kosten der Verfahren oftmals erheblich, wenn man z.B. bauliche Maßnahmen treffen musste, um die Mindeststandards und sonstigen Anforderungen zu erfüllen. In der Frage von Prostituierten erfahrener Gewalt ergab die Studie, dass ein knappes Drittel (28,5 Prozent) innerhalb von 12 Monaten mindestens einmal Opfer eines Deliktes wurde, am häufigsten erlebten sie sexuelle Belästigung (17,1 Prozent), zu jeweils rund einem Zehntel Betrug (11,3 Prozent), Diebstahl (9,8 Prozent) und Bedrohung (8,6 Prozent). 6,8 Prozent erlitten Körperverletzung, 4,3 Prozent Raub und 2,6 Prozent sexuelle Nötigung. Die Forscher:innen weisen darauf hin, dass einer nicht unwesentlichen Anzahl von Personen „mehrfach Viktimisierung in Form gewichtiger Straftaten“ widerfuhr, z.B. berichteten 40 Prostituierte von 288 Ereignissen sexueller Nötigung, 131 Sexarbeiter/innen von 487 Fällen von Körperverletzung.