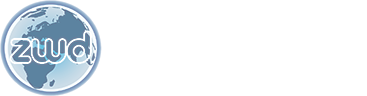zwd Berlin. Die Studie „Erfolgsfaktor Resilienz“ war der Frage nachgegangen, welche schulischen Faktoren die Resilienz von Schüler*innen befördern. Als resilient gelten diese, wenn es ihnen gelingt, trotz des relativ geringen sozialen Status der Eltern in allen PISA-Testfeldern mindestens die Kompetenzstufe 3 zu erreichen. „Ein geordnetes und lernorientiertes Klima im Klassenzimmer ist ein entscheidender Faktor hinter dem Schulerfolg bildungsferner Schülerinnen und Schüler. Wenn sowohl Schulleitung als auch Lehrkräfte den Willen und die Fähigkeit haben, ein solches Klima herzustellen, dann sind die Erfolgsaussichten größer als wenn einfach die Mittelausstattung steigt“, sagte der OECD-Direktor für Bildung, Prof. Andreas Schleicher, bei der Vorstellung der Studie in Berlin.
Laut den Ergebnissen der Studie ist in Deutschland zwischen 2006 und 2015 der Anteil resilienter Schüler*innen von 25 auf 32,3 Prozent gestiegen und damit so schnell wie in kaum einem anderen OECD-Land. Untersucht man die schulischen Faktoren, die Resilienz beeinflussen, dann sind es in Deutschland aber auch in den meisten anderen Ländern vor allem die soziale Mischung an der Schule und die Tatsache, dass Schüler*innen den Unterricht als störungsfrei und geordnet wahrnehmen.
Gute Schulausstattung nicht per se resilienzfördernd
Die Studienergebnisse geben Aufschluss über zwei Faktoren, die ein solch gutes Lernklima befördern können. Dies seien zum einen eine niedrige Lehrer*innenfluktuation, durch die sich eine offene Kommunikation und vertrauensvolle Beziehungen entwickeln können. Zum anderen brauche es eine motivierende Schulleitung, der es gelingt, das Lehrer*innenkollegium von einer gemeinsamen Mission zu überzeugen und auf strategische Ziele und Ergebnisse auszurichten. Mehr Ressourcen und eine bessere Ausstattung der Schulen führen hingegen nicht unbedingt zu einem höheren Anteil an resilienten Schüler*innen, so ein Ergebnis der Untersuchung. So wirkten sich weder kleinere Klassen noch eine bessere Ausstattung mit Computern positiv auf den Lernerfolg sozial benachteiligter Schüler*innen aus. Das bedeute allerdings nicht, dass Investitionen an Schulen keine Rolle spielten – vielmehr würden sie im Wesentlichen dann helfen, wenn sie den Lernprozess und die Lernumgebung effektiv verbessern. So zeigt die Studie insbesondere für Deutschland einen positiven Effekt von schulischen Aktivitäten jenseits des Unterrichts. Dies lasse nach Angaben der OECD darauf schließen, dass sich Investitionen in Ganztagsangebote positiv auf den Lernerfolg sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler auswirken.