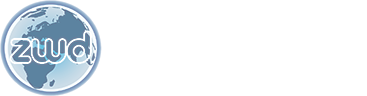Schon ein halbes Jahr früher, im Dezember 2015, hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen von einer „Bankrotterklärung für die Europäische Gemeinschaft“ gesprochen. Damals war in der entscheidenden Sitzung des EU-Sozialministerrates die Einführung einer Quote von 40 Prozent (des unterprivilegierten Geschlechtes) in Aufsichtsräten börsenorientierter Unternehmen gescheitert. Ein Grund dafür war die Vorgabe von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sich Deutschland bei der Abstimmung zu enthalten habe. Das stieß in vielen Medien auf Kritik und Unverständnis, denn wenige Monate zuvor war in Berlin mit Unterstützung der Kanzlerin eine nationale Frauenquote von 30 Prozent verabschiedet worden. Durchgängiger Tenor war nun, Merkel habe – gegen das Votum von Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) – durch mangelndes Engagement und ihre Enthaltungs-Vorgabe zur Verhinderung der Einführung der Frauenquote beigetragen. Besonders tragisch, zumal die beiden anderen Gremien der EU, die EU-Kommission und das EU-Parlament, die entsprechende Vorlage schon zwei Jahre zuvor abgenickt hatten.
Nur zwei Begebenheiten – und doch stehen sie für viele verpasste Chancen, ein Signal für die Gleichberechtigung von Frau und Mann zu setzen! Kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass einige Mitgliedstaaten die Gleichstellungspolitik der EU ausbremsen, weil sie nationale Befindlichkeiten höher bewerten?
Fakt ist, dass in einigen Mitgliedsländern geschlechterpolitisch emanzipierte Politikkonzepte der EU aufgenommen werden, während sie in etlichen anderen ignoriert werden. Vor dem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob es gelingen kann, die maßgeblichen und zukunftweisenden Richtlinien, die die EU im Bereich der Geschlechtergleichstellung erlassen und damit ein klares Bekenntnis zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gegeben hat, nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch umzusetzen! Eigentlich sollte im Kontext der Geschichte der Europäischen Union die Gleichstellung der Geschlechter eine Selbstverständlichkeit sein. Schon in der Geburtsstunde der EU 1957, der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, verpflichteten sich die damaligen sechs Gründerstaaten in den Römischen Verträgen, sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einzusetzen. Unter anderem wurde der Grundsatz festgeschrieben, dass Männer und Frauen gleiches Entgelt für gleiche Arbeit erhalten sollen. Doch fast 70 Jahre später ist die Lohngleichheit von Männern und Frauen immer noch nicht Realität. Und das, obwohl 2010 von der Europäischen Kommission erneut die Verringerung des geschlechtsspezifischen Einkommens- und Rentengefälles als einer von fünf Arbeitsschwerpunkten in die „Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010 – 2015“ aufgenommen worden war.
Nach Ablauf dieser Strategie – auf eine neue konnte sich die Europäische Union bisher nicht einigen – besteht in Europa immer noch ein geschlechtsspezifischer Gehaltsunterschied von durchschnittlich 16 Prozent. Wen wundert es, dass in Frankreich geringere Unterschiede bestehen als in Deutschland, sind doch dort bei Nicht-Einhaltung Sanktionen für die Unternehmen vorgesehen! Maria Noichl, in Bayern beheimatetes SPD-Mitglied des EP-Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, zieht daraus ihre Schlüsse: „Gesetzlich verpflichtende Maßnahmen ohne Sanktionen scheinen für die EU-Mitgliedstaaten, und so auch für die Unternehmen, nur die Wirkung mahnender Worte zu haben.“
Ein Indiz dafür, dass ein Handlungsrahmen zwar hilfreich sein kann, aber nicht ausreichend ist! Das Fazit daraus kann nur sein: Es genügt nicht, Richtlinien zu erlassen, ohne deren Umsetzung zu überprüfen und bei Missachtung zu ahnden. Gleichstellungspolitische Maßnahmen der EU müssen für die Mitgliedsstaaten rechtlich verbindlich sein – auch unter der Maßgabe, dass dadurch die Möglichkeit wegfällt, diese nationalen Gegebenheiten anzupassen.
Lohngleichheit ist nur ein Aspekt der Gleichstellung von Frauen und Männern. Gerade hat die ASF auf ihrer Bundes-konferenz in dem Antrag „Parité europaweit“ das Europäische Parlament aufgefordert, eine paritätische Gleichberechtigung von Frauen und Männern in den politischen Gremien seiner Mitgliedstaaten „als Ausdruck eines demokratischen Staatshandelns“ nach dem Vorbild des französischen Parité-Gesetzes einzufordern.
Der gerade erfolgte Brexit hat die EU aufgeschreckt. Ein Politikwechsel wird diskutiert – für ein solidarisches und soziales, ein weltoffenes und demokratisches Europa. In ein anderes Europa müssen auch die Frauen, die andere Hälfte der Menschheit, stärker in den Fokus genommen werden. Das Resümee von Justizminister Heiko Maas (SPD) zur Quote in Deutschland vom Juli 2016: „Das Ende der patriarchalen Systeme ist eingeläutet“ muss auch für Europa gelten. Die Gleichstellung der Geschlechter muss in der EU nicht neu gedacht werden, denn in vielen Fällen ist das europäische Recht dem nationalen Recht voraus. Notwendig ist aber, dass deren Realisierung mit Vehemenz und Verbindlichkeit (endlich) durchgesetzt wird.
Meine daraus resultierende Frage für die Debatte in unseremPOLITIKMAGAZIN lautet:
Wie kann es gelingen, die geschlechterpolitischen Maßnahmen und Initiativen der EU aus der Freiwilligkeit in die Verbindlichkeit zu transferieren?