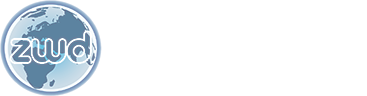zwd Berlin. Die Menschenrechtsorganisation AI konstatiert in ihrem am 29. April veröffentlichten Report 2024/ 25 weltweite Rückschläge bei Gleichstellung von Frauen, Diskriminierung von LGBTQI+ und einen Anstieg bei geschlechtsspezifischer Gewalt. „Feminist*innen und andere Aktivist*innen für die Rechte von Frauen und lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlechtlichen Menschen (LGBTI+)“ seien im Berichtszeitraum 2024 „massiven Angriffen“ ausgesetzt gewesen, schreibt AI-Generalsekretärin Dr. Agnès Callamard im Vorwort. Callamard prangert in vielen Ländern zu beobachtende Angriffe auf Frauenrechte an. In Afghanistan habe die Taliban-Regierung Frauen von der „Teilhabe am öffentlichen Leben“ ausgegrenzt, ihnen Rechte auf Bildung und Arbeit verweigert, der Iran habe mit neuen Verschleierungsgesetzen „die Unterdrückung von Frauen und Mädchen“ verschärft, für Übertretungen habe der Staat brutale Strafen vorgesehen.
AI: Staaten sollen geschlechtsspezifische Diskriminierung beseitigen
In der Analyse zum Bericht appelliert AI an die Regierungen der Länder, "geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt" zu beseitigen. Sie sollten "repressive Gesetze aufheben" und den "Zugang zu umfassenden Informationen und Dienstleistungen" im Bereich sexuell-reproduktiver Gesundheit garantieren, worunter auch sichere Schwangerschaftsabbrüche fallen. In zahlreichen Staaten Süd- und Mittelamerikas gab es laut Report „alarmierend viele“ Femizide. Argentinien habe trotz einer hohen Femizid-Rate von ca. 265 aus geschlechtsspezifischen Gründen getöteten Frauen Finanzmittel für Maßnahmen im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt gestrichen. Sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten habe teilweise drastische Ausmaße angenommen, z.B. im Bürgerkrieg im Sudan, wo geschlechtsbezogene Gewalt und Vergewaltigungen weit verbreitet seien, oder bei Kampfhandlungen in der Zentralafrikanischen Republik, wo allein im ersten Halbjahr über 11.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen gemeldet wurden.
Hohe Opferzahlen bei Partnerschaftsgewalt in Europa
Hohe Zahlen weiblicher Opfer von tödlicher Partnerschaftsgewalt in Europa verzeichneten nach AI-Angaben u.a. Bulgarien, die Bundesrepublik, Griechenland und Italien. Geschlechtsspezifische Gewalt sei in der Region immer noch ausgedehnt vorhanden. Mit Blick auf die Bundesrepublik stellte die Organisation u.a. die stark gestiegenen Fallzahlen geschlechtsspezifischer Gewalt, von Hassdelikten gegen Frauen, digitaler und häuslicher Gewalt, Menschenhandel und Sexual-Straftaten, besonders die hohe Zunahme bei durch (Ex-) Partner verübten Femiziden heraus. Wie AI berichtet, seien Migrantinnen, Sexarbeiterinnen sowie trans-Frauen in Staaten im europäischen Raum beim Versuch, sexualisierte Gewalttaten anzuzeigen, mit grundlegenden Hindernissen konfrontiert gewesen. In vielen Ländern Europas seien LGBTQI+-Personen weiterhin Problemen ausgesetzt, wie in Polen oder der Slowakei, wo sie Gewalt und Benachteiligungen erfahren hätten. Russland, Georgien und Bulgarien stimmten für eine Reihe homophober und transsexuellenfeindlicher Regelungen, die sich gegen angeblich "schwule Propaganda" richteten. Speziell Regierungen in der europäischen Region forderte AI auf, "Straffreiheit für alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt" aufzuheben und die „systemische Diskriminierung“ u.a. von LGBTQI+ „wirkungsvoll (zu) bekämpfen“.
Mehrere Länder entscheiden sich für Zustimmungsprinzip
Fortschritte erkennt der Menschenrechtsverein beim Bekämpfen sexualisierter Gewalt in mehreren europäischen Staaten, die mit Gesetzesreformen gegen Straflosigkeit bei Tätern einschritten. Tschechien, die Niederlande und Polen legten das Zustimmungsprinzip („Nur Ja heißt Ja“) ihrer rechtlichen Definition von Vergewaltigung zugrunde, Kroatien machte Femizide gesetzlich zum separaten Straftatbestand. Positiv habe sich die Rechtslage für LGBTQI+ in Griechenland entwickelt, das homosexuelle Ehen legalisierte, und in der tschechischen Republik, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften stärker an Ehegemeinschaften anglich. Außerhalb Europas führte Thailand als erstes südostasiatisches Land die gleichberechtigte LGBTQI+-Ehe ein, Japan, Taiwan und Südkorea erkannten Rechte von trans-Personen an. LGBTQI+ benachteiligende Gesetze, die gleichgeschlechtliche Ehen verbieten, beschlossen bzw. bestätigten hingegen Länder wie Mali, Malawi oder Uganda.
Bei den sexuell-reproduktiven Gesundheitsrechten spielte Frankreich dem AI-Bericht zufolge im globalen Vergleich eine Vorreiter-Rolle, indem es als erster Staat das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in seiner Verfassung verankerte. Mehrere europäische Länder (u.a. die Bundesrepublik) ergriffen Maßnahmen gegen sog. Gehsteigbelästigungen von abtreibungswilligen Frauen vor Arztpraxen und Kliniken durch sog. Pro-Life-Gruppen. In vielen Staaten Europas blieben Abtreibungen andererseits bis auf spezielle Ausnahmen strafbar, wie in Polen oder Malta. In Portugal, Italien und Kroatien konnten sich Gesundheitsfachkräfte aus Glaubens- oder Gewissensgründen weigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. AI verlangt entsprechend von den Regierungen, Erreichbarkeit umfassender sexuell-reproduktiver Gesundheitsleistungen inklusive Abtreibungen sicherzustellen.
BAG fordert konkrete Schritte für Vereinbaren von Beruf und Familie
Einige Tage vor dem Erscheinen des AI-Reports (23. April) wandte sich die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) mit einem offenen Brief an die künftige Bundesregierung. Lobend hob die BAG, wie vor ihnen schon der Deutsche Frauenrat (DF) in Reaktion auf den neuen Koalitionsvertrag, die Pläne von Union und SPD hervor, die alle Ressorts umspannende Gleichstellungsstrategie fortzuführen und das Vereinbaren von Beruf und Familie zu verbessern. Gleichstellung sei "unabdingbar für unsere Demokratie und für eine moderne Gesellschaft", betonte BAG-Bundessprecherin Tinka Frahm und rief die Regierung auf, Gleichstellung "auf allen Ebenen zu fördern und Nachteile zu beseitigen". Als positiv bewerteten die Feminist/innen die Verbesserungen beim Elterngeld und den anvisierten Mutterschutz für selbständig Tätige.
Um Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben voranzubringen, brauche es "zügige und konkrete Maßnahmen", wie "flächendeckende Kinderbetreuung“ oder Anreize für gerechtere Aufgabenverteilung bei Care-Arbeit, mahnte der Frauenverband. Die BAG kritisierte, der Koalitionsvertrag bleibe in zentralen Punkten der Gleichstellungspolitik zu vage. Was die Regierung zum begrüßenswerten Vorsatz ausführe, pflegenden Angehörigen einen Lohnersatz zu zahlen, trage unverbindlichen Charakter, kommentierte auch der DF. Die Bundesarbeitsgemeinschaft monierte, dass die Regierung nicht beabsichtige, das Ehegattensplitting bei der Lohnsteuer abzuschaffen, was "traditionelle Rollenbilder" zementiere und Frauen "in ökonomischer Abhängigkeit" halte. Sie bemängelte, dass Vereinbarungen zum Umweltschutz fehlten, in erster Linie seien jedoch Frauen die Leidtragenden des globalen Wetterwandels.
DF erwartet von Koalition auskömmliche Finanzierung der Vorhaben
Wie der DF sieht die Bundesvereinigung die restriktive Migrationspolitik der Regierung mit Sorge. Wenn der Familiennachzug ausgesetzt werde, betreffe das vor allem Frauen und Kinder, die in gefährlichen Lebensbedingungen ausharren müssten, überdies würden dadurch Fluchtwege für Frauen noch unsicherer. Die BAG unterstützt die im Koalitionsvertrag geplanten verschärften Strafen für Vergewaltigungen - durch Gruppen oder mit Schwangerschaftsfolge, setzt sich aber dafür ein, das Strafmaß für Vergewaltiger grundsätzlich, d.h. auch abseits bestimmter Konstellationen, wesentlich zu erhöhen. Beide Frauenverbände beanstanden, dass die Koalition nicht anstrebe, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Die "fehlende Entkriminalisierung" von Abtreibungen bezeichnete die BAG als "schwerwiegendes Defizit", das den Empfehlungen der von der Vorgängerregierung beauftragten Expert/innenkommission und dem Mehrheitswunsch der Bevölkerung widerspreche, die mit 75 Prozent für eine außer-strafgesetzliche Neuregelung des Paragraphen 218 (vgl. Umfragen im Auftrag des Bundesfamilienministeriums und von RTL/ ntv 2024) befürworte.
Der DF beurteilt es als günstig, dass Union und SPD Gleichstellung als wichtiges Anliegen begreifen. Hinsichtlich der Finanzierung sagte die DF-Vorsitzende Dr. Beate von Miquel, ihre feministische Interessenvertretung werde beharrlich dafür eintreten, dass die im Vertrag "genannten Vorhaben zugunsten von Frauen (...) prioritär umgesetzt" werden. DF-Geschäftsführerin Judith Rahner erwartet von der Regierung die Verwirklichung der Pläne mit "messbaren Zielen und ausreichender Finanzierung". Die Koalitionsparteien stellen in Aussicht, gleiche Löhne für weibliche und männliche Arbeitnehmer/innen durchzusetzen, wofür sie u.a. die EU-Transparenzrichtlinie in bundesdeutsches Recht überführen werden. Sie haben vor, für Schwangere in Konfliktsituationen die Versorgung mit medizinisch sicheren Abtreibungen zu gewährleisten. Die Gewaltschutzkonzeption des Bundes entwickeln sie zum Nationalen Aktionsplan weiter, stärken Prävention, Aufklärung und Täterarbeit.
Faeser: Gewaltschutz muss für neue Regierung „zentrale Aufgabe“ bilden
Der Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) zufolge erhöhte sich die Anzahl der Sexualdelikte, d.h. Vergewaltigung, schwere sexuelle Nötigung und Übergriffe, 2024 um 9,3 Prozent auf 13.320 Fälle an, 1.134 mehr Straftaten als im Jahr davor. 93,7 Prozent der Opfer waren Frauen, ein knappes Drittel von ihnen (29,0 Prozent) erlitt die Gewalttat durch einen (Ex-) Partner. Die geschäftsführende Innenministerin Nancy Faeser (SPD) unterstrich anlässlich der Vorstellung der Kriminalstatistik am 02. April, "Schutz von Frauen vor Gewalt" müsse auch für das neue Regierungsbündnis "eine zentrale Aufgabe" darstellen. Der Anstieg bei Vergewaltigungs-Verbrechen, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen bezeichnete sie als besorgniserregend. Faeser erklärte, die Zahlen müssten "Konsequenzen haben".
Faeser trat für eine wirksamere strafrechtliche Verfolgung der Täter und wie der Vorsitzende der Bundesinnenministerkonferenz und Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) für den Einsatz elektronischer Fußfesseln ein. Mäurer unterstrich, häusliche Gewalt müsse durch schnellere Strafverfolgung eingedämmt werden, Fußfesseln hätten die Funktion, "Frauen vor gewalttätigen Partnern effektiver zu schützen". Fälle von sexuellem Missbrauch stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent auf über 26.830, von sexueller Belästigung um 4,4 Prozent auf 20.150. Außer bei Sexualdelikten beobachtet die Statistik auch eine deutliche Zunahme der Gewaltkriminalität bei Kindern (+ 11,3 Prozent) und Jugendlichen (+ 3,8 Prozent). Als Einflussfaktoren vermutet das BKA psychische Belastungen, u.a. als weiter fortwirkende Folge von Corona-Maßnahmen, wirtschaftliche Sorgen und weniger Teilhabe, gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen und familiäre Konflikte, wie häusliche Gewalt oder zu geringes Engagement der Eltern für ihre Kinder.