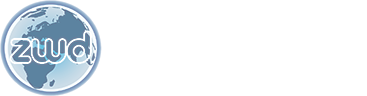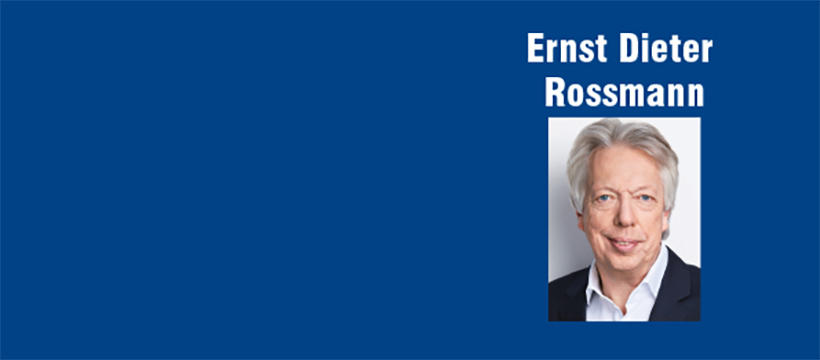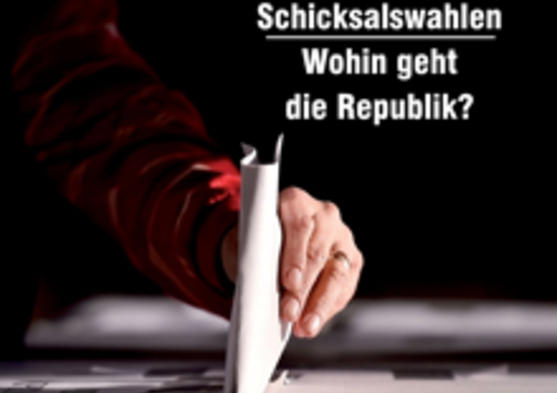Für einen neuen March for Science
Diese Angriffe sind eine Herausforderung in den USA selbst, sich mit allen rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Mitteln gegen diesen Ungeist an Diffamierung, Reglementierung und Instrumentalisierung von Wissenschaft zu wehren. Die Kräfte, die im April 2017 mit dem ersten March for Science in Washington D.C. eine weltweite Bewegung ausgelöst haben, müssen jetzt erst recht wieder zusammenfinden –
o als Zeichen der Solidarität mit denen, die in Amerika selbst kämpfen und in anderen Ländern, wo sie mit Tod und Verfolgung noch viel existentieller bedroht werden,
o als Warnung an alle Extremisten und Populisten auch in Europa, die Trump nachfolgen wollen, und
o als sichtbare Ermutigung, in der Verantwortung für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung auch gleichzeitig Verantwortung für eine friedliche und gerechte und nachhaltige Welt zu übernehmen.
Es ist gut, wenn Deutschland sich als „sicherer Hafen der Wissenschaftsfreiheit für Forschende aus aller Welt“, so der Koalitionsvertrag, verstehen will. Das „1000 Köpfe – Programm“ muss dabei noch zwingend um mehr Mittel für den Deutschen Akademischen Auslandsdienst DAAD), die Philipp-Schwartz-Initiative für gefährdete Wissenschaftler, die Entwicklungszusammenarbeit und um Initiativen der Science Diplomacy ergänzt werden. Freiheit, Schutz, Vernetzung, Austausch, Kooperation und Partnerschaft sind hierzu die Leitbegriffe, damit sich das ebenso kritische wie zukunftssichernde Potential von Wissenschaft und Forschung, wo immer es geht, entfalten kann.
Eine nachdenkliche Stimme aus Harvard
Solidarität darf allerdings nicht die einzige Konsequenz aus dem Kulturkampf gegen die Wissenschaft sein, wie er jetzt aus dem bigotten MAGA-Teil Amerikas geführt wird. Damit es nicht zu einem „Bürgerkrieg der Ideen“ kommt, so die Harvard-Professorin und Wissenschaftssoziologin Sheila Jasanoff in ihrem nachdenklichen Appell in der ZEIT vom 28. Mai dieses Jahres, muss es auch zu einer ehrlichen Überprüfung in der Wissenschafts-Community selbst kommen in Bezug auf Selbstgefälligkeit und Denkfaulheit im Umgang mit Ablehnung und Vorbehalten gegenüber Wissenschaft und Forschung in weiten Teilen der Gesellschaft. Sheila Jasanoff fragt:
- Wie kommt es, dass so viele Menschen nicht mehr das Vertrauen in „elitäre“ Institutionen wie Harvard haben und in die Autorität von Experten?
- Hat die Wissenschaftsgemeinschaft hinreichend reflektiert, dass sich aus Forschungsergebnissen keine bindenden Handlungsempfehlungen ergeben?
- Wie geht die Wissenschaft damit um, dass die Entscheidungen, die in ihrem Namen getroffen werden, nicht für alle Menschen gleich tragbar sind?
- Was tut die Wissenschaft, damit die Menschen nicht erklärungslos vor Fakten gestellt werden, ohne verstehen zu können, worin deren Legitimität besteht?
Peter Strohschneider, langjähriger Vorsitzender des Wissenschaftsrats wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat sich hierzu in seiner Kritik des autoritären Szientismus in seiner Streitschrift „Wahrheiten und Mehrheiten“ (München 2024) sehr kritisch u. a. mit der Ambivalenz des allzu populären Aufrufes „Follow the Science!“ auseinandergesetzt – hier die Chancen, über Wissenschaft und Forschung epochale Herausforderungen klug und wirksam zu bearbeiten, dort die gläubig dogmatische Alternativlosigkeit und Exklusion von anderen Menschen und deren Positionen und Sichtweisen.
Brücken der Wissenschaft in die Gesellschaft ausbauen – Aufgaben der Koalition
Dafür, dass hier die Brücken nicht eingerissen, sondern begehbar gemacht werden, sind auch in unserem Land noch viele Handlungsfelder intensiver zu bearbeiten. Der Koalitionsvertrag nennt den Ausbau der Wissenschaftskommunikation im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation und im Akademieprogramm. Versprochen wird auch eine längst überfällige unabhängige Stiftung für Wissenschaftskommunikation und -journalismus. Die Hochschulen selbst sollten ihr Engagement in der Third Mission erweitern und in der Zivilgesellschaft muss die Arbeit von Citizen Science an Breite gewinnen und viel populärer werden.
Und nicht zuletzt brauchen wir noch mehr Zirkulation zwischen den Systemen von Wissenschaft, Forschung und Politik auch über die Parlamente. Aktuell sind 2 Prozent der Volksvertreter auf Zeit im Bundestag vom Beruf her Hochschulprofessor:innen und 16 Prozent weisen über ihre Promotion wissenschaftliche Kompetenz nach. Zumindest von den Titeln her sind Wissenschaft und Forschung damit sehr gut vertreten. Was hieraus an kritischer und aufklärender Wirksamkeit in die Gesellschaft hinein erwächst, sollte umso mehr aufmerksam begleitet werden.
Dr. Ernst Dieter Rossmann ist ständiger Kolumnist des zwd-POLITIKMAGAZINs. Er ist Ehrenvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes und war langjähriger bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion sowie von 2018 - 2021 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Innovation.